8. September 2009
„Es gibt Wörter, die mich zum Ziel haben“. Zu Herta Müllers Roman „Atemschaukel“
Geschichtlicher Hintergrund und Stoffgrundlage des Romans „Atemschaukel“ von Herta Müller sind den Lesern dieser Zeitung vertraut, denn es dürfte kaum eine Familie geben, die von der fünfjährigen Deportation (1945 – 1949) der arbeitsfähigen deutschen Zivilbevölkerung Rumäniens zwischen 17 und 45 Jahren in sowjetische Arbeitslager nicht betroffen gewesen wäre. Dieses bis zu seinem Vollzug unvorstellbare Geschehen, das im kollektiven Bewusstsein als Teil der Verbrechen weiterlebt, die totalitäre Machtanmaßung im 20. Jahrhundert zu verantworten hat, ist geschichtlich erforscht, memorialistisch vergegenwärtigt und in der rumäniendeutschen Regionalliteratur auch schon literarisch gestaltet worden. Nun also in einem Roman von unbestreitbar überregionalem Rang.
Entstehungsgeschichte
Auch Herta Müller, deren Mutter fünf Jahre im Lager war, ist in der Familie auf das Thema gestoßen und hat, schon in der Absicht, darüber zu schreiben, seit 2001 weitere Zeitzeugen befragt. Aus Gesprächen mit dem ebenfalls deportierten Oskar Pastior (1927 – 2006) entwickelte sich der Plan, das Buch gemeinsam zu schreiben. Begleitet von Ernest Wichner und gefördert von der Stuttgarter Robert-Bosch-Stiftung reisten sie 2004 an die Stätten der ehemaliger Lager und veröffentlichten in der Zeitschrift „die horen“ 219/2005 die Fragmente Vom Hungerengel eins zwei drei. Nach Pastiors Tod galt es, das Gedruckte und Entworfene aus der rückerinnernden Erzähleinstellung einer kollektiven Erzählerinstanz auf einen rollendefinierten Ich-Erzähler zu übertragen. Es ist Herta Müller gelungen, dieses minimalinvasiv zu tun und den Roman völlig bruchlos in ihrer unverwechselbaren Sprechweise fortzuführen.Der Erzähler
Als Ich-Erzähler ist der siebzehnjährige deportierte Hermannstädter Leopold Auberg Erlebender, Erinnernder und Erzählender gleichzeitig. Als Erlebender hat er im Roman eine Gegenwart individueller Kontur, doch als Erzählender gleitet er so selbstverständlich vom Ich zum Wir, dass seine eigene Geschichte profilgebender roter Faden der eigentlich erzählten kollektiven Passion wird.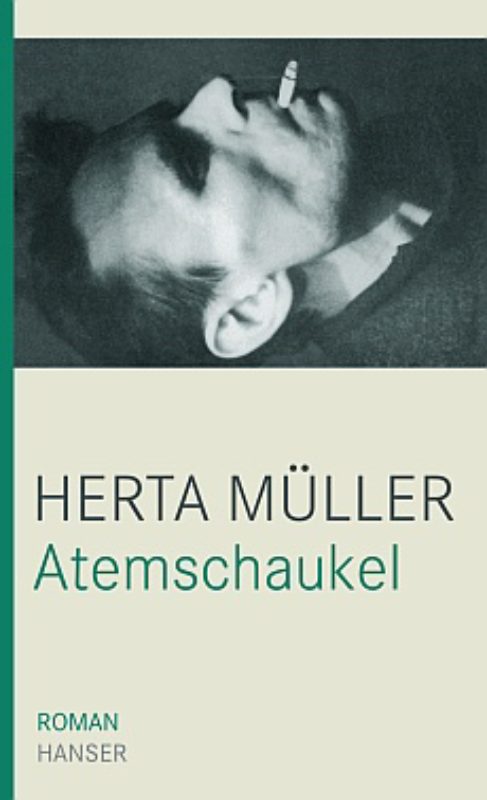
Das Erzählte
„Wie ausgemustertes Arbeitsvieh auf zwei Beinen“ sehen die „verbogenen räudigen Gestalten“ bei der Entlausung aus. Das ganze Ensemble der Lagerbedingungen hat sie dazu gemacht, allem voran die zur „Aufbauarbeit“ schöngeredete Plackerei. Zum erzählerischen Ereignis wird diese dadurch, dass von ihr in zwingender Umkehr normallogischer Verhältnisse geredet wird, so dass nicht die Insassen tätig sind, sondern Kohle, Zement, Sand, Kesselasche, „Schlackoblocksteine“ sie so tückisch im Griff haben, dass beispielsweise die beiden Kellerarbeiter sich ihr Tagwerk zwar redlich teilen, aber in den kärglichen Pausen auf dem „Schweigebrett“ sitzen, unfähig geworden, sich auszutauschen.Ganz ähnlich der Mangel an elementaren alltäglichen Bedarfsgütern wie Kleidung, Schuhwerk, Bettstatt oder Hygiene. Auch hier sind es die Lagergegenstände, die noch Jahre danach den Erzähler heimsuchen und ihm die Luft abschnüren. Denn wo in einer verkehrten Welt nichts mehr im Kopf ist als das Wissen „Kälte schneidet, Hunger betrügt, Müdigkeit lastet, Heimweh zehrt, Wanzen und Läuse beißen“, wird die Unnormalität zur Normalität. Dann verhungert die Frau, weil der Ehemann ihr das Essen stiehlt, dann sucht man selbst im Tod anderer nur noch den eigenen Vorteil. „Wer bin ich“, ist dann keine Frage mehr, es ist der menschliche „Nullpunkt“ erreicht, und der ist das „Unsagbare“. Oder das Unsägliche.
Die alles beherrschende Lagerpein ist jedoch der Hunger. Zu dem mühsam gezähmten chronischen kommt „unersättlich“ immer neuer hinzu, „bis man im Kopf kein Hirn, nur noch das Hungerecho hat“. Oder den Hungerengel. Diese Personifikation ist zweifellos eine erzählstrategisch hervorragende Erfindung. Der Hungerengel bewegt sich als häufigst genannte Person unter den anderen Personen, ihm kann man gegenübertreten, sich mit ihm auseinandersetzen oder sich ihm anheimgeben. Er geht mit dem verlorenen Sohn zu den Abfallhaufen, und wo zwei zusammenstehen, ist er unter ihnen. Freilich ist der Hungerengel weder Bote Gottes noch Heilskünder, sondern Verkehrung zum besessenmachenden Dämon. Ist es denkbar, dass eine eilige Rezensentin das verkannt und den Hungerengel als Herz-Schmerz-Vokabel des 19. Jahrhunderts missverstanden hat?
Auch für Herta Müller ist eine Geschichte erst dann zu Ende gedacht, wenn sie ihre schlimmstmögliche Wendung genommen hat. Etwa in dem überwältigenden Kapitel Eintropfenzuvielglück für Irma Pfeifer (siehe Leseprobe weiter unten), wo den Häftlingen Beistandsleistung ebenso versagt wird wie das Recht auf einen eigenen Tod. Einzig Freie bleibt die schwachsinnige Planton-Kati, die von der Lagerwirklichkeit nicht erreicht wird. Bei ihr stoßen die Befehlsgewaltigen auf ihre Grenzen, und die Insassen richten sich im Selbsttrost auf, dass sie zwar „zu allerhand, aber nicht zu allem fähig sind“.
Womit ein Blick auf die Peiniger zu werfen ist. Die Verfügungsgewalt über die Lagerinsassen wird weitgehend Artur/Tur Prikulitsch überlassen, der zwar Deportierter ist, aber dank seiner Russischkenntnisse zum Komplizen der Lagerleitung und zum halbseidenen Profiteuer aufgestiegen ist. Sadist, der Missionar werden wollte, oder „devot wie ein Ministrant“: Seine hinterhältige Zwienatur ist schon im Nachnamen angelegt, der im siebenbürgischen Volksaberglauben den Werwolf bezeichnet. Ähnlich tritt das beständige Zetern des Lagerkommandanten Schischtwanjanow schon aus den gehäuften Zischlauten seines Namens hervor, was Trudi Pelikan zu der Feststellung veranlasst, Russisch sei eine „verkühlte“ Sprache. Ihn widert das Elend der Insassen an, und es ist Hader mit sich selbst, wenn er sie im Kapitel Schwarzpappeln in eisiger Silvesternacht hinausbefiehlt und das unmögliche Ausheben von Gruben als Scheinerschießung inszeniert. Herta Müller fällt keine Urteile. Sie zwingt den Leser, es zu tun.
Erzählweise
Reale Schilderung und zeichenhafte Überhöhung fügen sich komplementär zu einem komplexen Lagerbild. Doch das Lager als geschlossener Raum, wo sich im Kopf „immer dasselbe dreht“ und allgegenwärtige Fremdbestimmung keinen Spielraum lässt, schließt einen narrativen Verlauf mit eindeutiger epischer Progression aus. Herta Müller hat adäquat darauf reagiert und den Text segmentiert, so dass das Buch den Eindruck einer Folge eigenpointierter Kurzgeschichten macht. Zumindest einige Kapitel lassen sich tatsächlich als veritable, an ihre meisterhaften frühen gemahnende Kurzgeschichten lesen. Diese sind andererseits aber untereinander motivisch sorgsam verhakt und werden durch Leitmotivisches („Ich weiß du kommst wieder“), Dingsymbole (Taschentuch, Schal) sowie durch ein enggeknüpftes Netz metaphorischer Zeichenhaftigkeiten (Hungerengel, weißer Hase, Herzschaufel, Atemschaukel u.a.) zu einer mosaikartig spielenden Romaneinheit gefügt. Bildgesteigertes Romangeschehen hat seinen Reflex in einer ebenso bildintensiven Sprache, die expressiv zupackend, sehr genau und schnörkellos nüchtern ist.Der Lagerraum und seine erzählgegenwärtig angehaltene „Hautundknochenzeit“ werden wiederholt von Wegblendungen durchsetzt, die Vergangenes assoziativ oder kontrastiv vergegenwärtigen, andersräumig Gegenwärtiges traumvisionär herbeizitieren und sich Zukünftiges vorwegnehmend aneignen. Die sechs letzten Kapitel heben sich nicht nur zeit-räumlich vom Hauptteil ab; durch die Raffung biographisch längerer Zeitläufte sowie die einsinnigeren Begründungen von Lebensentscheidungen scheint mir die dingliche Eloquenz hier zum Teil beeinträchtigt. Gleichwohl entfaltet das Thema erst in den Traumata, die das Lager auf Lebenszeit auslöst, seinen übergeordneten Sinn. Durch Erlebtes ausgestiegen aus der Zeit und aus sich selbst, ist der Heimkehrer zwar mit den Füßen daheim, aber auf Dauer zu Hause bleibt er im Lager. Denn es gibt immer Dinge, die „wollen mich nachts deportieren, ins Lager heimholen wollen sie mich“; und „es gibt Wörter, die mich zum Ziel haben, als wären sie nur für den Rückfall ins Lager gemacht“. Lager bedeutet lebenslänglich.
Prägung und Umprägung
Wenn ein junger Mann einer fünfjährigen Lehrzeit ausgesetzt wird und danach lebenslang mit den erfahrenen Prägungen umzugehen hat, so ähnelt das von der Anlage her einem umgestülpten Bildungsroman und der Lagereinschluss einer mörderischen Verkehrung der pädagogischen Provinz. Ich sage nicht, dass das so sei, auch nicht, dass Herta Müller das intendiert habe; ich sage bloß, dass der ungeheure künstlerische Resonanzraum, der sich als Wesentlichstes dieses Buch über den Tatsachenschilderungen auftut, auch diese Lesart möglich macht. Willfährige Ideologen haben diesen Gulag als Umerziehungsmaßnahme für die osteuropäischen deutschen Bevölkerungssplitter zu rechtfertigen gesucht. Indem sie klassische literarische Topoi umkehrbar werden lässt, setzt die Autorin dagegen die Wahrheit ins Recht.Ihre Umprägung zur Metapher nimmt der Lagerwirklichkeit nichts von ihrer realen Brutalität. Diese ist im Buch Seite für Seite gegenwärtig, doch Herta Müller hebt das Einzelne in künstlerisch erweiterten Bedeutungsraum. Darum zögere ich auch nicht, eine weitere gewagte Lesart zu versuchen. Als Metapher gelesen, verweist Nowo-Gorlowka, das eh schon exemplarisch für andere Lager steht, weiter auf den größeren erzwungenen Einschluss in das verräterisch so benannte „sozialistische Lager“. Manch einer, der fünfzig oder mehr Jahre darin gelebt hat, dürfte heute Leopold Aubergs Erkenntnis teilen: „Da komm ich nicht weg.“ Und wenn das metaphorische Lager einen entlässt, so nur, „um sich im Kopf zu vergrößern“. Womit auch dieser Roman mitten in Herta Müllers Dauerthema mündet: der Beschädigung des Menschlichen durch einen Totalitarismus. Doch dieses Buch blickt nicht in Zorn zurück, sondern umspielt die unabänderlichen Gegebenheiten mit anrührend zu Herzen gehendem resignativem Fatalismus, der sich in dem kurzen Kapitel Weißer Hase in sakraler Klage Luft macht.
Atemschaukel
Die wortschöpferisch schöne Titelmetapher der Atemschaukel wird auf dem Appellplatz eingeführt, wo plötzlich Ein- und Ausatmen nicht mehr zu trennen sind: „Die Atemschaukel überschlägt sich, ich muss hecheln.“ In Analogie zur Herzschaufel, der „Schaukel in meiner Hand“, die expressis verbis als „äußeres Gleichgewicht“ ausgelegt wird, ist auf die Atemschaukel als inneres Gleichgewicht zu schließen. Bezeichnenderweise fehlt aber dieser Vergleichsterminus im Satz ebenso wie das Gleichgewicht der Atemschaukel im Lager. Vom Hungerengel besetzt, wird sie zum schwindligen Delirium, und noch zu Hause ist sie zwar im Ticken der Uhr an der Wand, in der Brust jedoch fehlt sie auf Dauer wie die Herzschaufel. Und nachts, wenn Dinge und Wörter den Entlassenen anfallen, überschlägt sie sich wieder, und er muss hecheln.N. B.: Die Überlebenden dieses Geschehens, ihre Angehörigen und Nachfahren, wir alle: Banater Schwaben, Bukowiner, Sathmarer Schwaben und Siebenbürger Sachsen dürfen Herta Müller zutiefst dankbar sein. Als erstes für ein hervorragendes Stück deutscher Prosa, das tatsächlich „atemberaubend“ ist. Des Weiteren dafür, dass sie ein Thema, das in der deutschen Öffentlichkeit eher verdrängt wird, so überragend gestaltet hat, dass es zur Kenntnis genommen werden muss. Wie viele außer ihr hätten das vermocht?
Michael Markel
Herta Müller. „Atemschaukel“. Roman. München: Carl Hanser Verlag 2009. 304 Seiten, Preis 19,90 Euro, ISBN 978-3-446-23391-1.Eintropfenzuvielglück für Irma Pfeifer
Herta Müller: „Atemschaukel“, Leseprobe
Schon Ende Oktober schneite es Eisnägel in den Regen. Der Begleitposten und der Vorprüfer teilten uns die Norm zu und gingen gleich wieder ins Lager, in ihre warmen Dienststuben. Auf der Baustelle begann ein stiller Tag ohne Angst vor dem Geschrei der Kommandos.
Doch mitten in diesen stillen Tag hat Irma Pfeifer geschrien. Vielleicht HILFEHILFE oder ICHWILLNICHTMEHR, man hat es nicht deutlich hören können. Wir sind mit Schaufeln und Holzlatten zur Mörtelgrube gerannt, nicht schnell genug, der Bauleiter stand schon da. Wir mussten alles aus den Händen fallenlassen. Ruki na sad, Hände auf den Rücken – mit einer erhobenen Schaufel hat er uns gezwungen, tatenlos in den Mörtel zu schauen.
Die Irma Pfeifer lag mit dem Gesicht nach unten, der Mörtel machte Blasen. Erst schluckte der Mörtel ihre Arme, dann schob sich die graue Decke bis zu den Kniekehlen hoch. Ewig lang, ein paar Sekunden, wartete der Mörtel mit gekräuselten Rüschen. Dann schwappte er mit einem Mal bis zur Hüfte. Zwischen Kopf und Mütze wackelte die Brühe. Der Kopf sank und die Mütze hob sich. Mit den gespreizten Ohrenklappen trieb die Mütze langsam an den Rand wie eine aufgeplusterte Taube. Der Hinterkopf, kahlgeschoren mit den verkrusteten Läusebissen, hielt sich noch oben wie eine halbe Zuckermelone. Als auch der Kopf geschluckt war, nur noch der Buckel herausschaute, sagte der Bauleiter: Schalko, otschin Schalko.
Dann trieb er uns mit der Schaufel an den Baustellenrand zu den Kalkfrauen, alle auf einen Haufen, und schrie: Wnimanje liudej. Der Akkordeonspieler Konrad Fonn musste übersetzten: Achtung Leute, wenn ein Saboteur den Tod will, soll er ihn haben. Sie ist hineingesprungen. Die Maurer haben es vom Gerüst oben gesehen.
Wir mussten uns aufstellen und in den Lagerhof marschieren. Es gab an diesem frühen Vormittag Appell. Es schneite immer noch Eisnägel in den Regen, und wir standen von außen und von innen monströs still in unserem Entsetzen. Schischtwanjonow kam aus seiner Dienststube gerannt und brüllte. Um seinen Mund schäumte der Speichel wie bei einem überhitzten Pferd. Er warf seine Lederhandschuhe zwischen uns. Wo sie hinfielen, musste sich einer bücken und ihm den Handschuh jedesmal wieder nach vorne bringen. Wieder und wieder. Dann überließ er uns Tur Prikulitsch. Der trug einen Wachstuchmantel und Gummistiefel. Er ließ durchzählen, vortreten, zurücktreten, durchzählen, vortreten, zurücktreten bis in die Abendstunden.
Herta Müller
Atemschaukel. Roman
Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
Gebundene Ausgabe
EUR 12,50
Jetzt bestellen »
Atemschaukel. Roman
Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
Gebundene Ausgabe
EUR 12,50
Jetzt bestellen »
Anzeige · Bestellinformationen von Amazon.
Schlagwörter: Herta Müller, Rezension, Roman, Deportation, Kommunismus, Vergangenheitsbewältigung
62 Bewertungen:
Neueste Kommentare
- 16.10.2009, 13:14 Uhr von online-fan: Gerade mailte mir ein Freund: Die Atemschaukel von Herta Müller gibt es auch heute noch online ... [weiter]
- 10.09.2009, 19:47 Uhr von seberg: Das lasse ich mal einfach so stehen. Vielleicht verstehe ich es ja noch. Oder du übersetzt dein ... [weiter]
- 10.09.2009, 17:35 Uhr von Anchen: Nein, mir brennt nichts unter den Nägeln und es ist auch gut und richtig, das Buch die ... [weiter]
Artikel wurde 30 mal kommentiert.
Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.
