
|
Zeitzeugenbericht
Verschleppt ins Donezbecken, 1945
von Harald Lienert aus Heldsdorf
|
|
 Ein kurzer Auftakt Ein kurzer Auftakt
 Aushebung und Verfrachtung Aushebung und Verfrachtung
 Die Fahrt Die Fahrt
 Lagerleben im Donbass Lagerleben im Donbass
 Endlich nach Hause! Endlich nach Hause!
|
Ein kurzer Auftakt |
 |
|
Wegen der amerikanischen Bombenangriffe auf Kronstadt hatte unsere Familie im Frühjahr 1944 in Hamruden Zuflucht gesucht, im Elternhaus meiner Mutter.
In Reps, unserem "Stuhlsvorort", mussten sich nach Einmarsch der Roten Armee laut Aufruf alle männlichen Bürger deutscher Volkszugehörigkeit im Alter von 17-45 Jahren behördlich registrieren lassen. Mit meinen knapp 17 Jahren fiel ich also mit in diese Altersgruppe. Gleichzeitig konnte man aus öffentlichen Verlautbarungen erfahren, dass Rumänien durch den Waffenstillstand vom 23. August 1944 verpflichtet war, zum Wiederaufbau in der Sowjetunion 80.000 Arbeitskräfte zu stellen. Eine sachliche Verbindung zwischen der Registrierung und diesen Waffenstillstandsbedingungen kam mir erst etwas später zum Bewusstsein.
Vorerst schrieb ich mich in die 7. Klasse der Schäßburger Bergschule (Bischof-Teutsch-Gymnasium) ein, da Schäßburg der Kreisvorort von Hamruden war, wo wir zu der Zeit unseren Wohnsitz hatten. Kost und Quartier bekam ich bei einer bekannten Schäßburger Familie.
Der Schulbetrieb funktionierte auch beinahe normal, mit der Einschränkung, dass wir sächsischen Schüler jede dritte Nacht Pflegedienste im örtlichen Kriegslazarett zu leisten hatten. Das war eine "Vergünstigung" für Gymnasiasten, denn unsere übrigen Altersgenossen mussten in der Zeit schon in Bukarest Aufbauarbeit leisten zur Wiederherstellung der Bahnanlagen, die von amerikanischen - und nach dem Waffenstillstand von deutschen - Bombenangriffen zerstört worden waren.
Während der Weihnachtsferien, die ich zu Hause verbrachte, kamen erstmals Gerüchte über eine bevorstehende Verschleppung auf. Nun dämmerte es mir, dass unsere Registrierung im Herbst damit etwas zu tun haben könnte. Ich kürzte meine Ferien deshalb ab und fuhr schon einige Tage vor Unterrichtsbeginn zurück nach Schäßburg, wo ich ja nicht "registriert" war und daher hoffte, einer Verschleppung entgehen zu können. Mit anderen drei Klassenkameraden beschlossen wir am 12. Januar, als die Aushebungen begonnen hatten, außer der Reihe unseren Pflegedienst im Lazarett anzutreten, um nicht zu Hause angetroffen zu werden. Das ging auch 2 Tage lang ganz gut, denn die rumänischen Ärzte und Krankenschwestern waren uns wohlgesinnt und hätten uns auch nicht ausgeliefert. Doch am dritten Tag kamen die Eltern eines der in Schäßburg ansässigen Klassenkollegen an die Spitalspforte und baten ihren Sohn, sich den Behörden zu stellen, weil ihnen angedroht worden war, andernfalls selber der Deportation anheim zu fallen. Die beiden anderen Schäßburger Kollegen waren in der gleichen Lage. Was blieb mir da noch übrig? Es schien mir aussichtslos, allein im Lazarett zurückzubleiben, denn niemand wusste, ob wir letztlich nicht alle, gleich den Wolgadeutschen, nach Sibirien verschleppt würden. Daher, und wohl auch aus Gründen der Solidarität, zu der wir erzogen worden waren, entschloss ich mich, dahin zu gehen, wo anscheinend alle anderen auch hingehen mussten. Ich verließ also die relative Sicherheit des Kriegslazaretts am 15. Januar, in der Absicht, mich am nächsten Morgen "freiweillig" zu stellen. Vorsorglich packte ich eine Reisetasche und einen Rucksack mit den nötigsten Kleidungsstücken und etwas Proviant und legte mich gegen 22 Uhr nieder.
|
Aushebung und Verfrachtung |
 |
|
Ziemlich unsanft wurde ich aber durch ein Stimmengewirr geweckt. Als ich die Augen öffnete (es mag etwa 11 Uhr nachts gewesen sein) sah ich mich einer Gruppe von sieben fremden Männern gegenüber: vier Zivilisten, einem rumänischen Polizisten und zwei Rotarmisten. Nach einem kurzen Verhör zur Feststellung meines Alters von 17 Jahren, hieß es lakonisch auf russisch "Sabiraj", was soviel bedeutete wie "Pack dich". Ich folgte dieser Aufforderung, zog mich in aller Eile an und wurde vom Polizisten ins Sammellager eskortiert, das in der zu diesem Zweck ausgeräumten deutschen Mädchenschule eingerichtet war. Da verbrachte ich den Rest der Nacht auf der Stroheinstreu des Fußbodens, natürlich ohne dabei an Schlaf denken zu können.
Mein Aufenthaltsraum lag im ersten Stock. Am Vormittag des nächsten Tages warf ich zufällig mal einen Blick durchs Fenster und sah auf der Straße... meinen Vater. Da die reguläre Bahnfahrt für Deutsche zur Zeit verboten war, hatte er mit einem Güterzug die Schwarzfahrt gewagt, um mir noch einige Lebensmittel und warme Kleidung zu bringen. Durch ein zerbrochenes Fenster konnte ich gerade noch ein paar Worte mit ihm wechseln, doch dann kam der russische Posten und stieß ihn mit seinem Gewehrkolben weg.
Wenig später wurde ich mit einigen anderen Schicksalsgenossen in einen mit Zeltplane bespannten LKW verladen und zum Schulhoftor hinausgeführt. Durch einen Schlitz in der Planenrückwand sah ich dann meinen Vater mit vielen anderen vor dem Tor stehen, in der Hoffnung, mir die mitgebrachten Sachen doch noch übergeben zu können. Er aber konnte mich natürlich nicht sehen und ich mich von ihm daher auch nicht verabschieden. Der LKW brachte uns zum Bahnhof, wo sich inzwischen eine ganze Wagenkolonne angesammelt hatte. In einer längeren Wartezeit hatte irgend jemand in einem der Wagen das Siebenbürgenlied angestimmt. Ohne jeglichen Sichtkontakt stimmten von Wagen zu Wagen alle in den Gesang ein. Auf die gleiche Weise erklang dann noch das Bekenntnislied "Mer walle bleiwe wat mer senj" mit dem Schlußvers "Gott helf es etzt och enjden" (Gott helf' uns jetzt und immer). Dieses Lied kam aus innerster Überzeugung, denn Gottes Hilfe war nun wirklich das einzige, worauf wir noch hoffen konnten.
Bald erfolgte dann unsere Verfrachtung in Viehwaggons, 57 Personen in einen Zehntonner. Unser Waggon war mit stöckigen Pritschen aus rohen Fichtenbrettern ausgestattet. Ein Kanonenöfchen stand in der Mitte, mit einem kleinen Holzvorrat, der, solange er reichte, die Innentemperatur des Wagens auf etwa Null Grad erwärmen konnte. Abwechselnd konnten wir uns um das Öfchen herum stellen, um etwas mehr Wärme aufzutanken.
Als Abtritt diente ein Loch, das mit einem Beil in den Boden ausgehauen war.
|
Die Fahrt |
 |
|
Am Nachmittag ging die Fahrt dann los, von Schäßburg in Richtung Kronstadt, über den Predeal-Pass ins Prahovatal, entlang der Linie Ploiesti-Buzãu-Râmnicu Sãrat. Hier erfolgte der Umstieg aufs russische Gleis und entsprechend größere Waggons, in die jeweils 80 Personen eingepfercht wurden.
Über Mãrãsesti, Bârlad, Vaslui ging's in der Moldau weiter nach Norden, nahezu bis Iasi.
Im Zug verbreitete sich das Gerücht, unser König Michael würde sich der Ausfahrt des Zuges in sowjetisches Gebiet widersetzen. Welch blauäugige Vorstellung! Als wenn Seine Majestät, auch wenn er das gerade gewollt hätte, noch die Macht gehabt hätte, sich dem Willen der russischen Machthaber zu widersetzen. Sehr bald nach dieser Illusion ging die Fahrt also weiter nach Nord-Ost.
Unterwegs näherten sich an verschiedenen Haltestellen immer wieder mal fliegende Händler unserem Zug, um uns zu Wucherpreisen Gebrauchswaren anzubieten, wie Wurst, Schokolade und Seife. Einer unserer bewaffneten "Betreuer" wurde Zeuge eines solchen Handels. Zu unserem Staunen stürzte er sich wuterfüllt auf den "Händler" und entriss ihm den Korb mit seinen Waren, um ihn durch die geöffnete Luke des nächstbesten Wagens zu schleudern. Der Mann war somit um seinen Verdienst gebracht, aber das Verhalten des Soldaten erschien uns wie ein Akt der Solidarität mit den ihm anvertrauten "Schützlingen".
In dem Zusammenhang erinnere ich mich an noch eine Episode. Unsere Mädel und Frauen sangen gelegentlich, vor Heimweh oder wohl auch zur Selbstermutigung, verschiedene volkstümliche Lieder, unter anderem einmal auch eines nach der Melodie des Wolgaliedes. Nach dem letzten Ton ertönte ein lautes Klopfen von außen an die Wagenwand. Erschrockene Stille im Waggon, und in diese Stille dann der laute Ruf unseres Wachsoldaten: "A nu dawaj, ieschtscho ras Wolga, Wolga"! ("Nun los, nochmal Wolga, Wolga"). Erleichtert folgten die Sängerinnen diesem Wunsch nach Zugabe.
Durch diese beiden Vorkommnisse möchte ich zum Ausdruck bringen, dass sich unsere Bewacher uns gegenüber durchaus nicht gehässig verhielten, sondern uns sogar irgendwie bemitleideten. Vielleicht waren sie in ihrem Inneren überzeugt davon, dass sie es mit Menschen zu tun hatten, die genau so unschuldig an ihrem Schicksal waren wie die vielen Millionen ihrer Landsleute im "sozialistischen Vaterland".
Am 21. Januar erreichten wir nach einem von uns unbemerkten Grenzübertritt die Stadt Bãlþi in Bessarabien, die nun auf russisch Belzy hieß. Hier hatten wir drei Tage Aufenthalt, weil angeblich keine Lokomotive für die Weiterfahrt verfügbar war. Das Brennholz ging zur Neige, und das Trinkwasser musste rationiert werden, weil mangels Heizstoff kein Schnee mehr geschmolzen werden konnte...
Anschließend ging es dann trotzdem wieder weiter in östlicher Richtung. Über den Eindruck, den die durchfahrene Strecke auf mich machte, schrieb ich am 29. Januar in mein kleines Tagebuch:
Nun rollen wir schon einige Tage durch die Ukraine. Der Kälte wegen machen wir nur selten die Fensterluken auf. So sitzen wir die längste Zeit im Dunkeln. Die Fahrt scheint kein Ende zu nehmen. Wir fahren durch flaches Land, das nur selten von niedrigen Hügelketten durchbrochen ist, einer ungewissen Zukunft entgegen. Die Gegend ist öd und leer. Unter der geschlossenen Schneedecke kann man hie und da noch einen ausgebrannten Panzerwagen erkennen, stundenlang aber keine Ortschaften. Seit 15 Tagen bin ich nicht aus den Kleidern gekommen. Das Zeug klebt schon förmlich an meinem Leib, und unter der Wäsche beginnt es zu krabbeln: die ersten Läuse werden ausgemacht und durch Knicken versucht man sich ihrer zu erwehren.
Und im Tagebuch vom Dienstag, dem 30. Januar 1945, heißt es:
In der Nacht sind wir ziemlich flott gefahren und langten heute früh in Dnjepropetrowsk an. Unser Zug steht in einem unübersehbaren Werksgelände, ein Meer von Schloten umgibt uns.
Nach einem Tag Aufenthalt am Bahnhof dieser Industriestadt ging unsere Fahrt weiter nach Südosten und am 1. Februar kamen wir auf einer Haltestelle in der Nähe von Stalino an. Wir waren hier also im Donezbecken, das in russischer Abkürzung "Donbass" heißt. Die schwarzen kegelförmigen Erhebungen im Gelände muteten uns eigenartig an, denn wir hatten noch nie eine Abraumhalde des Steinkohlenbergbaus zu Gesicht bekommen.
|
Lagerleben im Donbass |
 |
|
Endlich, am 17. Tag unserer Abfahrt von Schäßburg, kamen wir am 2. Februar in der Bergbausiedlung Rjasnaja (Rayon Makejewka) an und wurden hier auswaggoniert.
Einige Kilometer weit schleppten wir uns mit unserem Gepäck durch den Schnee bis in das für uns improvisierte Lager. Das war mit Draht umzäunt und bestand aus mehreren Baracken. Zu zwölft wurden wir in einen Schlafraum mit vier Stockpritschen eingewiesen, wobei also jeweils 3 Mann auf eine Liegefläche kamen, die eigentlich für zwei vorgesehen war.
Nach der ersten Nacht auf kahlen Brettern kriegten wir Strohsäcke, die wir auf einer 6 Km entfernten Kolchose mit Stroh zu füllen hatten. Dort versuchten wir, Stroh mit möglichst wenig Schnee aus der Drift in unsere Säcke zu stopfen. Auf unserem Rückweg hatten wir das Glück, dass unsere Spuren, die wir uns durch den Schnee gebahnt hatten, noch nicht wieder verschneit waren.
Im Lager erfolgte sodann die Aufnahme unserer Personalien und die ärztliche Untersuchung, bei der wir fast durchwegs als "schachttauglich" befunden wurden.
Zu unserer Identifizierung erhielten wir runde, aus Konservendosen ausgeschnittene Blechmarken mit eingestanzten Nummern. Ich bekam die Nummer "P 112", die ich an meiner baumwollenen Arbeitsbluse befestigen musste. Dadurch war zum Arbeiter Nummer 112 geworden, auf russisch "rabotschij nomer sto-dwenazatj" , wobei der Buchstabe P das russische R für "rabotschij" bedeutete.
Vor unserer Einteilung in die Kohlengrube verrichteten wir noch einige Tage lang Gelegenheitsarbeiten: Verlegen von Telefonkabeln, Grubenholz schleppen, Auf- und Abladen von Lebensmitteln und anderes mehr.
Eines Mittags war es dann so weit, dass wir zum ersten Mal verköstigt werden sollten. Auf dem Weg zum Essraum, der "Stolowaja", begegneten wir einigen Kumpeln, die eben daher kamen. "Was gibt's zum Essen?" fragten wir. "Tomatensuppe", war die Anwort. Wunderbar, dachte ich, ist ja meine Lieblingssuppe. Doch was kriegte ich da in meinen Blechnapf? Warmes Salzwasser, in dem einige grüne eingesäuerte Tomaten schwammen. Das war also die russische Tomatensuppe. Alternativ gab es statt der Tomaten meist eine "Suppeneinlage" von Sauerkraut oder sauren Gurken, jeweils im gleichen Salzwasser gekocht.
Das Grundnahrungsmittel aber war "Kleb", ein dunkles, festes, sehr wasserhaltiges Roggenbrot, in Striezelform gebacken und pro Tag nach unterschiedlicher Arbeitsleistung rationiert:
Für Grubenarbeiter unter Tage: 1kg
Für Grubenarbeiter im Tagebau: 700 g
Leute, die wegen verschiedener Gebrechen nicht schachttauglich waren, wurden zu so genannter "leichter Arbeit" (ljochkaja rabota) eingeteilt, das heißt, sie mussten für Sauberkeit des Lagerhofes sorgen und für hygienische Entsorgungen aller Art. Dazu gehörte das Entleeren der Fäkaliengrube mittels Eimern in ein Fass, das auf einem zweirädrigen Karren hinausgeführt und außerhalb des Lagers in eine andere Grube geschüttet wurde. Mit dem gleichen Karren hatten die "Leichtarbeiter" auch die Toten aus dem Lager zu befördern und in der Nähe der Fäkaliendeponie zu begraben. Physisch auch nicht ganz leicht, denn die entsprechenden Gruben mussten erstmal in den steinhart gefrorenen Boden gegraben werden. Die "Leichtarbeiter" hatten dafür eine Tagesration von 500 g Brot.
Schließlich gab's noch die Arbeitsuntauglichen im Krankenrevier, die in der Regel sowieso schon unterernährt waren. Nach stalinistischem Prinzip ("wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen") bekamen sie immerhin täglich noch 350 g Brot.
Die obligate Suppe gab es für alle, bloß hatten die Grubenarbeiter zusätzlich noch einmal täglich das Recht auf einen Schlag Gersten- oder Hirsebrei ("Kascha").
Unter diesen Bedingungen begann unser Arbeitseinsatz unter Tage. Es wurde in 3 Schichten gearbeitet: Frühschicht von 7 bis 15 Uhr, Mittagsschicht von 15 bis 23 Uhr und Nachtschicht von 23 bis 7 Uhr früh.
Ich hatte von Anfang an Nachtschicht. Eine halbe Stunde mussten wir bis zur Arbeitsstelle gehen. Dort fuhren wir 250 m in die Tiefe ein, bis zur waagerecht verlaufenden "Strecke" auf der die Schienen für die Loren ausgelegt waren. Von der Strecke wurden dann die einzelnen Stollen schräg hoch getrieben, in Höhe von etwa 70 cm, in die man nur auf allen Vieren hinauf klettern konnte. Der Stollen war mit "Stempeln" aus Fichtenholz abgestützt und mittig mit einer Schüttelrutsche versehen, die elektrisch angetrieben war.
Ich war als Hilfsarbeiter zwei russischen Bergleuten ("Hauern") zugeteilt, die vor Ort die Kohle aus dem Flöz mit ihren Spitzhacken herausschlugen. Diese Kohle hatte ich mit einer kurzstieligen Schaufel in die Schüttelrutsche zu schippen, in der sie durch rhythmische Bewegungen nach unten auf die Strecke, direkt in eine bereitgestellte Lore geschüttet wurde. Die vollen Loren wurden von meist weiblichen Kumpeln bis zur Weiche geschoben, von wo sie per Drahtseilzug ans Tageslicht befördert wurden.
So ging das also eine Zeitlang, für mich eine physisch und psychisch äußerst belastende, ungewohnte Beschäftigung.
Eines Nachts hatte ich während der Arbeit einen quälenden Durst. Von der Stollendecke tropfte und rieselte dauernd Wasser herunter und sammelte sich Pfützen, auch in meiner Nähe. In der Annahme, dass Sickerwasser in so großer Tiefe doch trinkbar sein müsse, trank ich einige Schluck von dem klaren Nass. Es war mir allerdings noch nicht bekannt, dass sich in Bergwerken scharenweise Ratten aufhielten, die von den Kumpeln nicht nur geduldet, sondern sogar gepflegt wurden, weil sie als "Frühwarnsystem" vor schlagenden Wettern geschätzt waren. Leider sind Ratten aber auch Überträger von krankheitserregenden Amöben, wodurch das Wasser, sogar in dieser Tiefe, verseucht werden kann.
Schon am Ende der Schicht, nachdem ich das offensichtlich verseuchte Wasser getrunken hatte, bekam ich einen entsetzlichen blutigen Durchfall. Im Lager meldete ich mich im Krankenrevier. Das Thermometer ergab über 40 Grad Fieber und der Lagerarzt diagnostizierte mir eine Dysenterie, also "Ruhr".
In kurzer Zeit war ich durch den Flüssigkeitsverlust völlig entwässert und nahm rapide an Gewicht ab. Medikamente gab's keine. Die einzige Maßnahme, die gegen meine Krankheit in Frage kam, war eine strenge Diät: ab sofort keine russische Suppe mehr, sondern zur Wiederherstellung des Wasserhaushalts lediglich abgekochtes Wasser, etwas später dann auch den Brei, aber vor allen Dingen Brot, das ich mir zur besseren Verdaulichkeit in Schnitten teilte und auf dem Herd trocknete. Einen Teil der Brotschnitten ließ ich auch zu Kohle verbrennen (Pflanzenkohle!) und kochte mir daraus einen "Krustenkaffee", den ich hinfort statt Wasser trank. Mein Durchfall blieb zwar wässerig, war aber nicht mehr blutig. Bei der Kost konnte ich allerdings mein Körpergewicht nicht wieder herstellen und blieb ein so genannter Dystrophiker und somit arbeitsunfähig.
Ich war natürlich nicht der Einzige, der an dieser Krankheit litt, aber viele andere aßen trotz ihrer Ruhr weiterhin die mörderische Kraut- oder Gurkensuppe und starben reihenweise. Im Frühjahr hatten wir in unserem kleinen, 800 Leute zählenden Lager über 200 Tote. Darunter waren aber kaum Siebenbürger Sachsen, sondern Deportierte aus Polen und Ungarn, die im März 1945 in bereits erheblich geschwächtem Zustand in unser Lager dazugebracht worden waren.
Ich hingegen war "Dauerpatient" im Krankenrevier. Ich hatte somit unendlich viel Zeit und nützte sie einerseits für Holzschnitzereien, deren ich eine ganze Menge verschenkte und einige auch als Andenken behielt. Es war echte "Sträflingsarbeit". Zudem versuchte ich mich auch im Zeichnen, denn zum Glück hatte ich mir einen kleinen Zeichenblock und einen Bleistift mitgebracht und auch behalten können.
So zeichnete ich zum Beispiel den Ausblick aus dem Fenster meines Krankenreviers auf das Lager und die nächste Umgebung: das Grundschulgebäude von Rjasnaja.
 Ausblick aus dem Fenster meines Krankenreviers auf das Lager und die Grundschule Rajasnaja (Originalskizze)
Ausblick aus dem Fenster meines Krankenreviers auf das Lager und die Grundschule Rajasnaja (Originalskizze) |
Der Sommer kam. Ich und andere "Dystrophiker" mögen wohl zurecht für den sowjetischen Wiederaufbau zunehmend unrentabel geworden sein, und es gingen Gerüchte um, denen zufolge Kranklentransporte zusammengestellt werden sollten, zum Abschub in die Heimat.
Mitte Juni kam zum ersten Mal eine ärztliche Kommission ins Lager, um unseren Gesundheitszustand zu überprüfen und eine Auslese der Arbeitsuntauglichen für einen Heimtransport vorzunehmen.
Eine Ärztin führte diese Untersuchung durch, die sich in der Hauptsache auf das Befühlen der Beinmuskulatur beschränkte. Mein Muskelschwund schien ihr noch nicht genügend fortgeschritten zu sein, denn ihr Verdikt lautete: "On molodoj, jeschtscho moshet rabotatj sdjes" ("Er ist noch jung, kann hier noch arbeiten").
Einige Zeit später kam ich nach einer weiteren Untersuchung doch noch auf eine Krankenliste und im August war es dann so weit, dass wir unsere Sachen packen mussten und auf einem LKW nach Mospino in ein Sammellager gebracht wurden. Alle Anzeichen sprachen dafür, dass es nun bald tatsächlich nach Hause gehen sollte.
Einzeln wurden wir durch ein "Amtszimmer" geschleust, um nach Strich und Faden gefilzt zu werden. Fast alles, was wir nicht am Leibe trugen, wurde uns abgenommen und fein säuberlich auf einer Liste vermerkt. Diese Liste mussten wir unterschreiben. Zu welchem Zweck, weiß ich nicht. Ich vermute aber, dass wir durch unsere Unterschrift bestätigen sollten, unser Hab und Gut freiwillig zu Nutzen der noch dort Verbleibenden abgegeben zu haben.
Aber die Hoffnung, dass wir nun alsbald auf einen Heimtransport verladen würden, ging leider nicht in Erfüllung. Von August bis November mussten wir noch warten, bis ein Zug zusammengestellt war. Wir hatten keine warmen Sachen mehr und auch keine Decken zum Zudecken. Drei Wochen lang war der blanke Lattenrost unsere Liegestätte, bis wir endlich Strohsäcke bekamen. Zum Glück hatte ich beim Filzen im August meinen Mantel trotz dem damals heißen Sommerwetter angehabt und ihn deswegen behalten dürfen. Glück hatte ich auch mit einem 45-jährigen Mann namens Hans Markel aus Marienburg bei Schäßburg, den ich "Hans-Onkel" nannte. Er war mein Bettnachbar und nachts rückten wir aneinander und wärmten uns gegenseitig.
An den warmen Sommertagen verbrachten wir die meiste Zeit im Freien, wo ich dann wieder mal mein Skizzenbuch zückte und mein Lagerumfeld von Mospino zeichnerisch zu Papier brachte.
 Mein Umfeld im sommerlichen Sammellager von Mospino (Originalskizze)
Mein Umfeld im sommerlichen Sammellager von Mospino (Originalskizze) |
|
Endlich nach Hause! |
 |
|
Spätherbst war es geworden, vom Himmel fielen die ersten Schneeflocken. Dann endlich, am 23. November, kam der erlösende Befehl zum Abtransport. Auf einem LKW wurden wir nach Burros gebracht, einem Bahnhof bei Handschonowka, und hier auch gleich einwaggoniert. Mein guter Hans-Onkel stand mir da zur Seite, denn ich schwankte wie ein Rohr im Winde, die eine Hand am Stock, in der anderen die (nun zu meinem Vorteil!) fast leere Reisetasche.
Zusammen mit ungarischen Staatsangehörigen waren wir insgesamt 52 Mann in einem Viehwaggon. Die Verpflegung war im Vergleich zu den bisher gewohnten Verhältnissen ganz gut. Wir bekamen täglich 400 g Brot und zweimal täglich Suppe, in der sogar häufig Kartoffelstückchen schwammen. Fast schien es, als ob uns die Sowjetmacht nun etwas aufpäppeln wolle, um durch unser erbärmliches Aussehen nicht das Image des "Arbeiterparadieses" zu schmälern.
Über Dnjepropetrowsk ging die Fahrt in Richtung Nordwesten. An den Birken und Nadelhölzern konnten wir erkennen, dass wir eine nördlicher verlaufende Strecke zurückfuhren, als die, auf der wir gekommen waren.
An Znaminka uds Kaminka vorbei kamen wir nach 5 Tagen in Smerinka an, wo wir einen Tag lang stehen blieben. Am 25. November hielt unser Zug noch einmal in Borki, 12 km vor Tarnopol. Schon befürchteten wir, in Richtung Lemberg weiter zu fahren, doch dann ging es plötzlich nach Süden auf Czernowitz zu und zweigte danach wieder nach Südwesten ab, in die Karpato-Ukraine. Am 2. Dezember überquerten wir in den nördlichen Ostkarpaten den Körösmezö-Pass und passierten kurz darauf die sowjetisch-rumänische Grenze.
Im Durchgangslager Sighet wurden wir entlaust und gebadet, d.h. heiß geduscht. Um unsere entlausten Kleider zu empfangen, mussten wir nackt durch einen eisig kalten und zugigen Schleusenraum gehen, was für mich nicht ohne Spätfolgen blieb.
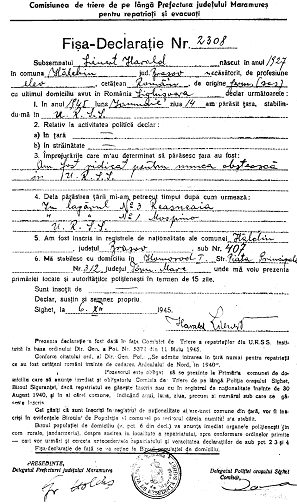 "Fisa-declaratie" (Erklärungsbogen) aufgenommen und ausgefolgt von der Repatriierungskommission für Deportierte und Evakuierte bei der Präfektur des Komitates Sighetul Marmatiei.
"Fisa-declaratie" (Erklärungsbogen) aufgenommen und ausgefolgt von der Repatriierungskommission für Deportierte und Evakuierte bei der Präfektur des Komitates Sighetul Marmatiei. |
| |
Anschließend wurden wir wieder mal registriert und mussten vor der Repatriierungs- kommission eine Erklärung abgeben, die als Dokument für unsere "Wieder- eingliederung" ins rumänische Staatsgebiet erforderlich war.
Fünf Tage dauerte es, bis wir diesen Entlassungsschein bekamen.
Am Abend des 7. Dezember konnten wir schließlich in einem regulären Personenzug abfahren, angeblich in Richtung Großwardein. Da es aber auf rumänischem Staatsgebiet keine direkte Zugverbindung zwischen Sighet und Großwardein gab, mussten wir erst durch vormals tschechoslowa- kisches, nunmehr aber sowjetisches Gebiet fahren, um an einem anderen Grenzübergang, bei Halmeu, wieder nach Rumänien zu kommen. Bis dahin lief das russische Gleis. Wir mussten also hier wieder aussteigen und zu Fuß über die sowjetisch-rumänische Grenze gehen, wobei wir zuerst von den russischen und dann von den rumänischen Grenzern abgezählt wurden.
Am Grenzbahnhof Halmeu lösten wir auf Grund unseres Entlassungsscheines eine unentgeltliche Fahrkarte bis zum Bestimmungsort Reps (Rupea) via Großwardein und bestiegen erstmals wieder einen rumänischen Personenzug.
Mittlerweile hatte uns aber der Winter richtig eingeholt und heftige Schneeverwehungen behinderten den gesamten Zugverkehr des Landes. Mit zwei Tagen Verspätung kamen wir in Großwardein an. Hier wurden wir weitere zwei Tage vom Roten Kreuz verpflegt, bis wir unseren nächsten Zug kriegen konnten.
Sehr langsam und in Etappen ging's dann weiter, doch in Teius war endgültig Schluss. Die Schneemassen auf den Gleisen widersetzten sich ungerührt der Kraft unserer Lokomotive. Wir mussten den Zug also verlassen. Durch Schnee und beißende Kälte wankte ich an der Seite meines treuen "Hans-Onkels" in die warme, aber stickige Atmosphäre des überfüllten Wartesaales. Mir wurde schwarz vor den Augen und ich muss einen sehr besorgniserregenden Eindruck gemacht haben, denn ich hörte neben mir wie aus dem Nebel eine sehr deutliche Stimme, die sagte :"Ãla moare pânã acasã." ("Dieser stirbt bis nach Hause"). Diese bedrohliche Äußerung rief meine Lebensgeister auf den Plan, so dass ich mein volles Bewusstsein wieder erlangte.
 Meine Fahrkarte von Halmeu nach Reps (Bahnhof Rupea)
Meine Fahrkarte von Halmeu nach Reps (Bahnhof Rupea) |
Am nächsten Tag hatte ich das Glück, zusammen mit einigen Kameraden in einem Kleintransporter bis nach Schäßburg fahren zu können, und von hier dann mit einem Linienbus nach Reps. Ein bekannter Hamrudener Bauer stand zufällig mit seinem Pferdewagen auf dem Repser Marktplatz und nahm mich natürlich gerne mit nach Hamruden.
Die Freude meiner Eltern über die unverhoffte Ankunft ihres "verlorenen Sohnes" war groß, und meine Odyssee somit zu Ende.
Es folgte für mich allerdings noch ein unliebsames Nachspiel, denn in Sighet hatte ich mir in der Eiseskälte nach dem warmen Duschbad eine Rippenfellentzündung zugezogen, die mich trotz baldiger physischer Erholung noch monatelang daran hinderte, meinen Schulbesuch fortzusetzen.
Erst ab Herbst 1946 konnte ich mich nach zwei Jahren Unterbrechung erneut in die 7. Klasse der Schäßburger Bergschule einschreiben...
|


 |
Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.
Karlstraße 100 · 80335 München · Telefon: 089/236609-0
Fax: 089/236609-15 · E-Mail: info@siebenbuerger.de
|


 |
|

 Homepage Homepage
 Sitemap Sitemap
 Impressum Impressum
 Seite empfehlen Seite empfehlen
 Druckversion Druckversion
|

