31. Januar 2022
Die überzählige Großmutter/Die Schriftstellerin Ruth Eder in der Reihe „Lebendige Worte“ (XXVII)
Ruth Eder wurde in eine traditionsreiche Kronstädter Familie hinein geboren, allerdings 1947 in Stuttgart, wo sie auch bis zum Abitur lebte. Ihr Großvater ist der siebenbürgische Maler Hans Eder (siehe Roman-Cover unten). Bereits während ihres Studiums der Germanistik und Theatergeschichte in München arbeitete sie als Autorin, aber auch als Schauspielerin und Regieassistentin bei Tageszeitungen, Theater, Film und Fernsehen. Sie lebte eine Zeitlang in den USA. Nach dem Magister-Examen (M.A.) war sie bei renommierten Zeitungen und Zeitschriften als Redakteurin und Autorin tätig, zuletzt als leitende Redakteurin beim Münchner Lifestyle-Magazin Ambiente. Seit der Geburt ihrer Tochter und Heirat mit einem Kollegen ist sie als freie Autorin, Journalistin und Moderatorin tätig.

Textauszug aus Eders neuem Romanmanuskript „Evergreen“
„Dei Mudder isch aber komisch angezoge“, sagte eine Schulfreundin zu Judith. Sie war acht und schämte sich. Sie war anders als die anderen. Ein Flüchtling, schlimmer noch, ein Ausländerkind. Ihre ganze Familie war anders. Wenige Tage später holte ihre Großmutter sie vom Ballettunterricht ab. „Da unde beim Portier wartet dei Oma auf di“, meinte eine Balletteuse zu Judith. „Ka die überhaupt Deutsch?“. Judith schämte sich erneut ihrer Andersartigkeit. Eine Achtjährige will nicht anders sein. Sie will dazugehören.Wenn sie Schwäbisch sprach, wie die anderen, sagte ihre elegante Mutter mit den kühlen Händen und den langen, silbern lackierten Fingernägeln: „Ich verstehe dich nicht.“ Ihre Mutter wollte nicht, dass sie war wie alle anderen Kinder. Judith hingegen wollte das Anderssein loswerden, aber es ging nicht. Es blieb an ihr haften, wie sehr sie sich auch bemühte. Wie das Pech an Pech-Marie.
Ihre Eltern kultivierten ihr Anderssein. Es schien sie interessant zu machen. Später sagte jemand zu Judith, dass ihre Eltern in Stuttgart richtige Paradiesvögel gewesen seien. Exotisch irgendwie. Ihre Mutter zog sich extravagant an, viel zu auffallend für ihren Geschmack. Warum konnte sie nicht nach Mutti aussehen, wie die Mütter ihrer Freundinnen. Die hatten keine lackierten Fingernägel und putzten, wenn Judith zum Spielen kam. Sie sah ihre Mutter selten putzen. Ihre Mutter schrie die Hausbesitzerin an wegen der Kehrwoche, die sie lächerlich fand und unter ihrer Würde. Danach musste Judiths Vater wieder alles ausbügeln. Er war auch anders, aber gefälliger als ihre Mutter. Er war vor Judiths Geburt ja auch rumänischer Diplomat gewesen. „Im Krieg in Berlin“, sagte er und Judith fragte nicht nach. Das schien so weit weg.
Im Tennisclub mokierten sich die Eltern ihrer Freundinnen, dass sie am Sonntag kein Sonntagskleid trug und sich beim Spielen schmutzig machen durfte. Sie kletterte auf Bäume, obwohl sie ein Mädchen war. Und sie saß mit ihrem Vater ab und zu in der Badewanne. Doktorspiele interessierten sie deshalb nicht. Sie wusste längst, wie ein erwachsener Mann nackt aussah. Ihre Freundinnen fanden das komisch und deren Eltern waren schockiert. Man lud sie eine Weile nicht mehr zum Spielen ein. Aber sie bemerkte auch die Blicke, die die Mütter ihrer Freundinnen ihrem Vater zuwarfen. Und sie sah, wie sich die Väter spreizten, wenn sie mit ihrer Mutter sprachen. Judith war lebhaft, sprach laut, sie lachte laut und ungehemmt, ja sie nieste sogar laut. Zu laut für die Kinderfeste ihrer Freundinnen. Niemand hatte ihr je gesagt: Sei leise. Sei still, du störst. Kinder haben leise zu sein. Leisezutreten.
Ihre Schulfreundin Gabi hatte rote Kniestrümpfe, alle anderen hatten die auch. Sie bekam keine, obwohl sie sich diese Strümpfe sehnlich wünschte, weil ihre Mutter es spießig fand, etwas tragen zu wollen, was alle anderen auch trugen. Judith wurde nicht getauft, sie wurde dafür ins Ballett geschickt, sie spielte schon als Kind auf Tennisturnieren. Die anderen taten das alles nicht. Sie litt darunter, ohne es irgendjemandem zu sagen. Bis sie eines Tages selbst den Reiz der Andersartigkeit entdeckte.
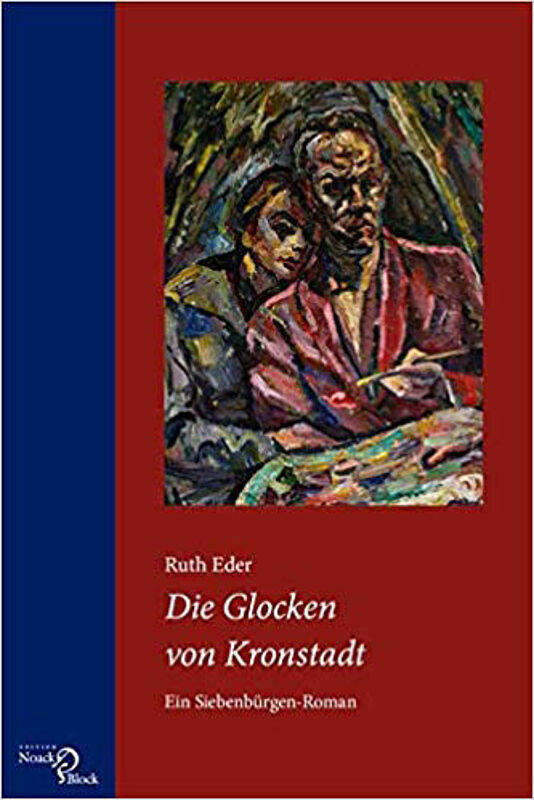
„Du bist immer so komisch angezogen, “ sagte ihr Mann viele Jahre später zu ihr und ging mit ihr einkaufen. Er wollte, dass sie trug, was er aussuchte, denn er hat Geschmack und sie nicht, sagte er. Erst ging sie mit zum Shoppen, denn eigentlich wollte sie ihm gefallen. Aber dann wurde sie plötzlich stur und störrisch, meinte er jedenfalls. Sie wollte so komisch angezogen sein, wie es ihr passte. Und sie genoss es auf einmal, sich von ihm und seiner Familie zu unterscheiden, obwohl sie anfangs alles daran gesetzt hat, zu ihnen zu gehören.
Judith war 13, als sie eine neue Großmutter bekam.
Es war Frühling im Jahr 1961. Sie hatten einander nie zuvor gesehen. Bis dahin war die neue Großmutter für sie nicht viel mehr gewesen, als ein Name und eine Handschrift auf bräunlichem, fasrigem Papier, die meist mit Bleistift rund und sorgfältig hingemalt war. Die Umschläge rochen fremd und ärmlich und die bunten Briefmarken darauf schien niemand in ihrer Klasse zu sammeln.
Die neue Großmutter war 71 und die Mutter ihres Vaters. Sie kam nach Deutschland, weil ihr Mann, jener Großvater, von dem man ihr erzählt hat, dass er Bilder malte, nun nicht mehr lebte und sie damit das Versprechen, das sie ihm am Sterbebett gegeben hatte, einlöste. Ihre Eltern sprachen längere Zeit viel über „Familienzusammenführung“. Sie kannte niemanden, dessen Familie zusammengeführt werden musste. Auch wenn bei einigen „seit dem Krieg“, wie es immer hieß, die Väter fehlten.
Es war schon gegen Abend, als ihr Vater losfuhr mit dem hellblauen Opel Kadett. „Ich fahre jetzt nach Salzburg und hole deine neue Oma ab, damit sie nicht ins Lager für Spätaussiedler muss“, sagte er fröhlich und ging. Judith hatte doch schon eine Oma. Sie wusste aber auch, dass er seine Mutter 20 Jahre lang nicht gesehen hatte. Das konnte sie sich überhaupt nicht vorstellen. Ihre Mutter war immer da. Eigentlich musste er doch sehr aufgeregt sein, dachte sie. Aber das zeigte er nicht, sondern verbarg alles unter einer dicken Schicht von guter Laune, wie er es immer tat.
„Sie kommt mit dem Orientexpress aus Bukarest“, sagte ihre Mutter. Orientexpress klang sehr exotisch und interessant. Es machte ihr nichts mehr aus, dass Angehörige ihrer Familie, die sie noch nie gesehen hatte, mit dem Orientexpress reisten. Niemand in ihrer Klasse hatte eine Oma, die er überhaupt nicht kannte und die mit solchen Zügen fuhr. Früher hätte sie das sehr peinlich gefunden.
Es war komisch, dass ihr Vater plötzlich das Kind von jemandem war. Er war auf einmal der Sohn einer alten Frau, die in wenigen Stunden auftauchen würde. An ihrer Hand war er früher einmal gegangen. Irgendwo weit weg in einer anderen Welt, die hinter dem „Eisernen Vorhang“ lag, wie ihre Eltern und Lehrer sagten. Sie versuchte immer, sich einen eisernen Vorhang vorzustellen, der links und rechts an der Grenzstation festgemacht war. Dann musste sie lachen. In der Staatsoper, an der sie als Ballett-Elevin tanzte, gab es so einen eisernen Vorhang, falls es auf der Bühne brannte.
Sie hatte richtig Lampenfieber, als sie mit ihrer Mutter vor dem Schwarz-Weiß-Fernseher wartete. Es lief „77 Sunset Strip“ und sie schwärmte für Cookie, der hatte so eine lustige Reibeisenstimme. Dass ihre Mutter eine Mama hatte, war für sie normal. Oma war immer schon da gewesen, seit sie zurückdenken konnte. Sie lebte mit in der Familie und Judith hatte keinen Bedarf an Großmüttern mehr.
Sie schlief längst, als sie Licht in ihrem Jungmädchenzimmer weckte. Sie blinzelte. Vor ihrem Bett stand eine alte Frau ganz in Schwarz, zierlich, das weiße Haar streng aus dem schönen, ernsten Gesicht gekämmt. Ihre Augen waren ungewöhnlich groß, größer als auf den Fotos, die sie von ihr gesehen hatte. Dunkel und aufmerksam. Wie ein Nachtvogel, dachte Judith. Der Nachtvogel schaute lange und genau und schwieg. Der Enkelin wurde unter diesem Blick unbehaglich.
„Du gefällst mirrr“ sagte die überzählige Großmutter, wobei sie das R sehr stark rollte, viel stärker noch als ihre Eltern, was ihr noch immer manchmal peinlich war, obwohl sie allmählich anfing, ihr Anderssein richtig zu genießen. Besonders bei den Jungen in der Tanzstunde. Die fanden sie aufregend und interessant. Dann ging die neue Oma aus dem Zimmer und machte lautlos die Tür hinter sich zu.
Diese Großmutter war die Tochter eines Dorfpfarrers aus dem siebenbürgischen Nest Weidenbach, ein paar Kilometer von Kronstadt entfernt. Und die Frau eines Mannes, der „unten“, wie sie sagte, ein bedeutender Maler gewesen war. Judiths Großvater. Anfangs waren sie sich unendlich fremd. Sie hatten in verschiedenen Welten gelebt, wussten nur aus Erzählungen und Briefen voneinander. Wo fängt man an miteinander, wenn man als 71jährige einen bleichen Teenager mit zu großen Zähnen vorgesetzt bekommt und als 13jährige eine unverhofft hereingeschneite Großmutter?
Sie kamen ins Gespräch. Allmählich immer mehr. Sie mochten sich von Anbeginn. Judiths Gefühl für die neue Großmutter setzte sich zusammen aus Neugier, Mitleid und auch ein bisschen Distanz, denn sie fühlte sich der alten Großmutter gegenüber zur Treue verpflichtet. Jedes Mal spürte sie Schuld, wenn sie lieber die neue, interessante Oma in ihrem Zimmer besuchte, als die vertraute ihrer Kindheit, obwohl die auch exotisch war. Auch ihre Mutter sah es lieber, wenn sie sich mit der alten Großmutter beschäftigte, auch wenn sie es nicht direkt aussprach.
Als kleines Kind, wenn ihr Opa zu Besuch kam, der Mann ihrer ursprünglichen Großmutter, fühlte sie sich auch manchmal schuldig. Er erzählte so schöne blutrünstige Geschichten von der Bärenjagd in den Karpaten und von seinen Jagdhunden Tasso und Waldi, dass die vertrauten Gute-Nacht-Geschichten ihres Vaters für ein paar Tage an Glanz verloren. Noch Jahre später hatte sie Schwierigkeiten, zwei Menschen parallel ihre Aufmerksamkeit zu widmen.
Die überflüssige Großmutter sprach viel von ihrer Kindheit. „Ich bin mit meinen Brüdern und Schwestern sehr harmonisch aufgewachsen im Pfarrhaus“, sagte sie oft. „Es war ganz mit Efeu überwuchert und stand direkt neben der Kirchenburg.“ Die Enkelin konnte sich nicht recht vorstellen, was eine Kirchenburg war, traute sich aber nicht, zu fragen. Sie merkte auch schnell, dass die eigentliche Zeitrechnung ihrer neuen Großmutter erst begann, als der Großvater sie aus ihrem beschaulichen Leben im Pfarrhaus zu sich holte. Sie spürte, dass dies Leben seit seinem Tod eigentlich zu Ende war. Man sah es in den Augen der neuen Großmutter, die niemals mitlachen, auch wenn sie lächelte.
„Er hat im Februar bei meinem Vater um meine Hand angehalten, weil er wollte, dass ich ihn zu einem Faschingsball begleite“, erzählte sie. „Und das hat mein Vater nur erlaubt, wenn wir uns vorher verloben. Das war noch vor dem Ersten Weltkrieg.“
Sie trugen die neue Großmutter auch an einem Nachmittag im Februar zu Grabe. Wie damals am Verlobungstag in Kronstadt lag noch etwas Schnee. Die neue Großmutter kam vom Dorf und wurde auch auf einem Dorffriedhof nahe Stuttgart begraben. Nur dass zwischen den beiden Dörfern halb Europa lag. Zwischen dem Grab der Großmutter und dem ihres Mannes, von dem ihr der Abschied so schwer gefallen war, erstreckten sich mehr als tausend Kilometer.
Viele Jahre später erinnerte sich Judith noch daran, dass die neue Großmutter immer ein wenig nach Kölnisch Wasser und nach Rouge geduftet hatte. Und dass ihre starke, tiefe Stimme nie so recht zu ihrer zierlichen Gestalt passte, die sie seit dem Tod ihres Mannes ausschließlich in Schwarz kleidete. Am Hals hatte diese Großmutter immer irgendein buntes Seidentüchlein getragen. Sie hatte ihr Versprechen gehalten und war zu ihrem Sohn und dessen Familie nach Deutschland gegangen. Aber heimisch war sie dort nicht mehr geworden.
„Einen alten Baum verpflanzt man nicht“, sagte Judiths ursprüngliche Großmutter, die immer ein bisschen eifersüchtig auf die „Neue“ gewesen war. „Steh grad“, sagte die ursprüngliche Großmutter auch oft. Sie stand dann hinter der Enkelin und steckte mit resoluten, genauen Bewegungen ihr Kleid aus giftgrünem Taft ab, das sie ihr für den Abschlussball der Tanzstunde nähte. Sie presste die Lippen aufeinander, weil ein Kranz bunter Stecknadeln dazwischen steckte. „Den Rock mach ich noch etwas weiter und darüber kommt Tüll. Mehrere Lagen, “ sagte sie, sprach das „darüber“ wie „darieber“ aus und rollte das R wie jeder andere in der Familie. Außer Judith. Die Enkelin sah sich im Geist bereits mindestens fünf Petticoats aus rosa Schaumgummi darunter tragen. Die Jungen würden schauen, weil niemand so angezogen war wie sie.
Im Zimmer der ursprünglichen Großmutter, wo diese Anproben für gewöhnlich stattfanden, sah es aus, wie in dem siebenbürgischen Heimatmuseum, das sie ihrer Enkelin in einem Buch gezeigt hatte. Leinenstickereien, in dunkelbrauner Wolle auf Naturleinen gestichelte, uralte Motive, Lebensbäume, Rosenmuster. Auf dem Tisch mit den schönen Biedermeierstühlen, die sie bei Nachlassversteigerungen zu Spottpreisen erworben hatte, standen siebenbürgische Tonkrüge, manche aus vielen Scherben mit Klebstoff sorgfältig zusammengesetzt.
Mitten im Zimmer ein hölzerner Webstuhl, auf dem Oma manchmal Wollteppiche mit Persermustern knüpfte. In diesem Zimmer hing, so erinnerte sich Judith später, immer der Geruch von Wolle und Leinen in der Luft, gemischt mit dem Duft von Pfefferminzbonbons, die in runden, marmorierten Kugeln in einem Porzellanschälchen auf Omas Nachttisch standen. Daneben ihr Nähkästchen. Die Enkelin kramte gern darin, probierte Fingerhüte an und wickelte das schon verschlissene, nach Gummi riechende Zentimetermaß neu auf. Das ganze Kästchen hatte seinen Geruch angenommen.
Am Fenster stand eine alte Pfaff-Nähmaschine. Die, wenn sie die Großmutter mit dem Fußpedal in Betrieb nahm, laut ratternde Geräusche von sich gab. Das Geräusch bildete für viele Stunden von Judiths Kindheit die Hintergrundmelodie.
„Denk dir, ich war einmal eine reiche Erbin und bin vierspännig durch die Stadt gefahren, damals in Siebenbürgen“, sagte die ursprüngliche Großmutter manchmal eher verwundert als bedauernd. Sie war im Gegensatz zu der neuen Großmutter nicht mit der Vergangenheit geschlagen. Sie lebte ganz im Heute und trauerte nicht.
Für Äußerlichkeiten, wie sie es nannte, und dazu zählten Seidentüchlein, Rouge oder Kölnisch Wasser, wie es die neue Großmutter hielt, kam der ursprünglichen Großmutter im Alter jeglicher Sinn abhanden. Sie wurde dick und trug ungeniert die Kleider ihrer ebenfalls dicken Schwiegertochter auf. Sie sparte „Lastenausgleich-Zahlungen“ für ihre Immobilien in Siebenbürgen und kam bald wieder zu einem gewissen Wohlstand. Sie ging, obwohl schon weit über 70, ohne Angst täglich allein im Wald spazieren. Den Schlüsselbund zur Verteidigung fest in der Hand.
Ihr Schwiegersohn, Judiths Vater, vermisste an ihr, wohl zu Recht, den Sinn fürs Höhere. Weshalb er ihr aus dem Weg ging. Wenn sie sich unvorhergesehen trafen in dem weitläufigen Haus, murmelte er ein geniertes „Küss die Hand“ und verschwand. Judith lebte lange in dem Glauben, dass die ursprüngliche Großmutter „Küss die Hand“ hieß.
Über ihren Ehemann sprach diese Großmutter so gut wie nie. Er lebte irgendwo in Bayern und kam, ein zarter Mann mit dünnen Beinen, manchmal für ein paar Tage zu Besuch. Er ließ sich auf Spaziergängen, die er dann mit der Enkelin unternahm, von anderen alten Männern mit „Herr Major“ anreden. Es sagte, er sei früher k und k Offizier gewesen. Sie fragte ihn einmal, was dieses k und k bedeute. Er sagte, das wäre die kaiserlich-königliche Armee Österreichs gewesen und dass er im Ersten Weltkrieg Adjutant des Kronprinzen gewesen sei. Die Enkelin stellte ihn sich deshalb als eine Art Musketier vor. Das und seine Geschichten über die Braunbärenjagd in den Karpaten gefielen ihr sehr. Obwohl niemand in ihrer Klasse einen Bären jagenden Opa hatte.
Kurz bevor er starb, kam er ganz zur Familie, zu seiner Frau zurück. Die ursprüngliche Großmutter saß täglich an seinem Sterbebett, denn sie war noch immer seine Frau. Trotz allem. „Köscenem“, sagte er zum Schluss auf Ungarisch zu ihr, „Danke.“ Die Enkelin erinnerte sich später vor allem an die Tränen ihrer Mutter, die von ihrer Nase tropften. Sie hatte sie bis dahin noch niemals weinen sehen. Die ursprüngliche Großmutter überlebte ihren Mann um 34 Jahre. Als sie mit 93 starb, hielt Judith ihre Hand. Sie war jetzt 39. Diesmal war sie da, anders als bei der überflüssigen Großmutter.
Auf den Gräbern der Großmütter pflanzt sie den Sommer über immer blaue und rote Blumen in den Farben Siebenbürgens. Die Friedhofverwaltung sieht das nicht gern, denn die üppig wuchernden Pflanzen halten sich nicht an die in deutschen Friedhofsordnungen vorgeschriebenen Grab-Abmessungen. Es hat schon mehrere Beschwerdeschreiben gegeben, die Judith ignoriert.
Schlagwörter: Lebendige Worte, Ruth Eder, Schriftstellerin, Journalistin, Kronstadt
84 Bewertungen:
Noch keine Kommmentare zum Artikel.
Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.