27. Februar 2022
"Das ursprüngliche Bild der Dinge wiederfinden": Zu Hans Bergels Erzählungsband "Die Stunde der Schlangen"
Im Rückblick auf die sozialistischen Diktaturen lässt Hans Bergel in seinem neuesten Buch – dem Band „Die Stunde der Schlangen. Zehn Erzählungen“ – eine der Gestalten sagen: „Die absichtlich herbeigeführte Gleichgültigkeit des Einzelnen dem Gemeinwesen gegenüber sicherte den Herrschenden die Macht. Zugleich unterlief sie freilich deren Bestand. Aber die Zeit, die darüber verging, war unser Leben“ (S. 84). Fragen nach individueller Verantwortung und politischer Macht, nach Indifferenz und Gemeinschaft, nach Vergänglichem und Bleibendem, gestellt aus der Perspektive einer Lebensbilanz und -prüfung, sind gleichzeitig zentrale Themen in den zehn Prosastücken.

Die Texte waren, wie in der Einleitung mitgeteilt wird, ursprünglich als Hauptkapitel des dritten Bands der Roman-Trilogie „Finale“ gedacht. Erzählt der erste Roman, „Wenn die Adler kommen“ (1996), die Geschichte der Zwischenkriegszeit in Europa am Beispiel einer Familie, so behandelt der zweite, „Die Wiederkehr der Wölfe“ (2006), die Ereignisse während des Zweiten Weltkriegs und stellt ein „Epos der europäischen Leidensgeschichte im Spiegel einer Region“ (George Guţu) dar. Band drei sollte der epischen Aufarbeitung der Epoche von 1945 bis 1989/1990 vorenthalten sein. Der Autor verzichtete darauf, die Trilogie zu vervollständigen – aus Gründen, über die er sich nicht äußert.
Ähnlich wie Bergels Meisterwerk von 1977, „Der Tanz in Ketten“, war der dritte Roman als Rahmenerzählung geplant, wobei die einzelnen Prosastücke von einem dramatischen Bogen verbunden sein sollten. Dies erklärt die Gemeinsamkeiten zwischen den zentralen Figuren in „Die Stunde der Schlangen“. Sie gehören allesamt zu Bergels Generation, und obwohl sie aus unterschiedlichen Ecken Europas und vielerlei biografischen wie beruflichen Kontexten kommen, ist ihnen jene gewisse Schärfe des Blicks gemeinsam, die die Fähigkeit zur (Selbst-)Reflexion ermöglicht, den inneren moralischen Kompass aktiviert und das permanente Suchen, das vulkanhafte Erleben und eine Weltoffenheit zur Folge hat, die kulturelle Grenzen überschreitet.
Nicht allein sind die Texte dicht und mit der für Bergel typischen Vitalität geschrieben, die Dramatik ist zum Zerreißen gespannt, der dokumentarische Blick bleibt unentwegt messerscharf und die epische Verarbeitung der Zeitgeschichte erhellend. Wenn wir noch dazu vom Autor erfahren, dass „ausnahmslos alle Erzählungen/Novellen von realen Vorgängen ausgehen“, gefriert einem als Leser das Blut in den Adern – wie beim Anblick von Schlangen, die dem Band den Titel verleihen. Wenige Symbole weisen diese Bedeutungsdichte auf. In Bergels Erzählungen treten uns eher furchteinflößende Eigenschaften der Schlangen (mit menschlichem Antlitz) entgegen: Zerstörkraft, Gespür in der Verfolgung der Beute, giftiger Biss, Kälte des Lauerns.
Bergels Erzählkunst der „großgearteten Sprachgebärde“ (Hermann Pongs) ist vielfach gelobt worden – sie steht hier seinen anderen Werken in nichts nach. Eindeutig drängt sich beim Lesen dieser Prosatexte die Frage nach der Haltung des Einzelnen in Zeiten kollektiver Niedertracht auf. Zweifelsohne ist die Novelle „Der Tod im Schlosshof“, die den Band eröffnet und in den 1980er Jahren spielt, nicht nur eine der besten epischen Arbeiten des Autors überhaupt, sondern auch in diesen Zusammenhängen ein Musterbeispiel. Dank eines Einstiegs in medias res befindet sich der Leser sofort im Pulsschlag der Erzählung; er entkommt der Faszination des Ereignisses nicht wieder. Die Vorgänge um den einzelgängerischen und sammelleidenschaftlichen Museumskustos Claus-Bastian Curtius sind erschütternd. „Übergeordnete“ Interessen verhindern die Aufklärung der Umstände seines gewaltsamen Todes und machen eine der Schwachstellen unserer Gesellschaft sichtbar. Der Kenner ist versucht, hinter dem Schloss Hellberg in der Novelle das Schloss Horneck zu vermuten. Bergels Widmung – „In memoriam Rolf Schuller (1930-1982)“ – legt diesen Schluss nahe.

Einen Aufschrei gegen Mechanismen, Menschentypen und Verhaltensweisen, aus denen sich diktatorische Systeme speisen, stellt die titelgebende Erzählung dar. „Die Wandlungen des Dr. Fulda oder Die Stunde der Schlangen“ ist in dramatischer Steigerung aufgebaut, die dem Charakterwandel der Hauptfigur folgt. Der Kunstwissenschaftler Claudiu Marius Fulda entwickelt sich aus einem Feingeist zu einem Verfolgten, dessen Groll, Angst und Empörung schließlich in Hass und Rachepläne umschlagen. Auch hier wird nicht nur das Einzelschicksal beleuchtet. Der Autor hält Verrätern, falschen Freunden, Spitzeln, Servilen und Wetteiferern um die Gunst der Mächtigen einen Spiegel vor. Kritisiert werden auch westliche Intellektuelle, die bis heute als unbefleckte Wegweiser des Geistes gepriesen werden, obwohl sie die Schlächter der roten Diktatur verkannten, gar feierten. Die Erzählung trägt eindeutig autobiografische Züge. Vor allem der Satz „Dass du so bist, wie du bist, mit deinen Interessen, deinen Neigungen, deinem Urteil und deinen Kenntnissen, all das ist in jeder Minute die Absage an ihre Weltsicht“ (S. 106) erinnert an den Titel einer Studie von Sven Pauling über den Kronstädter Schriftstellerprozess von 1959: „Wir werden Sie einkerkern, weil es Sie gibt!“ (2013). Wer sich eine weitere Aussage des Textes vor Augen hält – „Wir leben seit jeher in einer Welt der Raubtiere“ (S. 121) –, denkt unweigerlich nicht nur an die „Adler“ und die „Wölfe“ des vergangenen Jahrhunderts, sondern an die „Schlangen“ von heute, deren „Stunde nicht abgelaufen ist“ (S. 123).
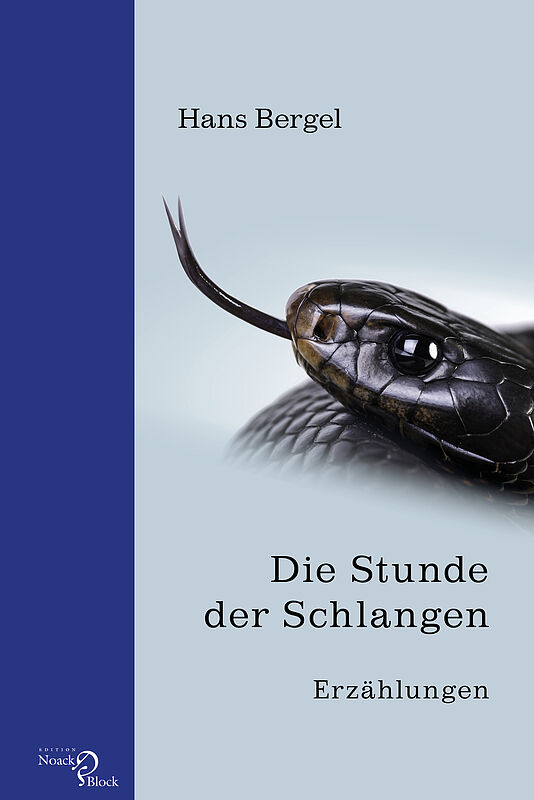
Die Erzählung „Die Entrückten“ handelt aus einer ganz anderen Perspektive vom Leitmotiv der inneren Freiheit (Ani Bradea), das Bergels Gesamtwerk kennzeichnet. Die Ereignisse spielen im Siebenbürgen des Jahres 1948. Eine Familie entscheidet sich angesichts bevorstehender Enteignungsmaßnahmen, den Mächtigen der Stunde „weder den Gefallen noch die Ehre“ zu erweisen „die Nerven zu verlieren“ (S.175). Deshalb werden Gegenstände aus Jahrhunderten, jeder mit eigener Geschichte, vom verstaubten Dachboden geholt und ins (sicherlich auch symbolische) Feuer geworfen, in das schließlich auch die Beteiligten „bis zurück ins siebte Glied“ steigen. Durch diesen Akt gelingt es ihnen, die Würde zu wahren. Sie nehmen innerlich Abschied von ihrer Heimat – nicht etwa, weil sie in die Ferne ziehen wollen, sondern weil diese Heimat vor ihren Augen untergeht. Bergels Plädoyer für „die Würde unseres Abgangs aus der geschichtlichen Existenzform, die noch bis gestern die unsere war“, aus der Rede vor dem Kölner Dom (1982), bildet sicherlich das historische Pendant zu dieser Erzählung.
Der Band „Die Stunde der Schlangen“ enthält auch Texte, die von Literaturkritik und Publikum bereits rezipiert wurden, und die hier in grundlegend überarbeiteter Fassung erschei- nen. „Am Todestag meines Vaters“ beispielsweise wurde in den 1970er Jahren mit einem Erzählerpreis gewürdigt. Es geht um den endgültigen Abschied von einer Kulturlandschaft, die kurz vor dem Zweiten Weltkrieg zwischen den Großmächten zermalmt wurde: dem von Deutschen bewohnten Budschak, der Steppe zwischen Pruth, Dnister und Schwarzem Meer. Kaum ein Historiker befasste sich mit dem Schicksal dieser Menschengruppe. So wird Bergels wuchtige Erzählung zugleich zum literarischen wie historischen Dokument vom Ende einer Kindheit und ebenso vom Ende einer Welt, mitsamt der „Menschen, die einst dort lebten“ und der „Art, wie die Menschen dort miteinander redeten“ (S. 71).
„Die Rückkehr des Rees“ erschien bereits im Band „Im Feuerkreis“ (1972) und beschreibt das Donaudelta mit seiner „archaisch-labyrinthischen Wirklichkeit“ zugleich als „geschehnisbestimmend“ und Stimmungsraum (Peter Motzan) eines dramatischen Ereignisses. Es ist der Bericht eines Künstlerschicksals. Was die Landschaftsbeschreibungen in dieser Novelle, aber auch etwa in „Die längste Nacht des Jahres“ oder „Der Leopard“ angeht, sei nur soviel angemerkt: Die Sprache, der sich der Autor bedient, erzählt nicht von Naturgewalten, sie ist selbst Naturgewalt.
Um abschließend noch einmal auf die Roman-Trilogie „Finale“ zurückzukommen, die als Erzählung der europäischen Geschichte das 20. Jahrhunderts angedacht war: Hier wäre zu fragen, wessen „Finale“ eigentlich von Bergel gemeint ist. Jenes der Siebenbürger Sachsen? Von ihnen heißt es unverkennbar in der Erzählung „Die Entrückten“: „Wir haben hier getan, was wir tun sollten und wollten. Es braucht uns keiner mehr. […] Es ist das Finale“ (S. 171). Geht es aber vielleicht nicht auch allgemein um die unzähligen Kulturlandschaften, Gemeinschaften, Völker, die das 20. Jahrhundert auf Nimmerwiedersehen zerstört hat? Um das alte Europa? Oder geht es gar um das Finale einer Welt, wie wir sie kennen, begleitet vom Gefühl, dass „wir niemals wieder festen Boden unter den Füßen haben würden“ (S.172)? Diese Frage bleibt offen, jeder Leser wird sie wohl anders beantworten. Der Autor bietet dramatische Bilderfolgen, um – so wie Curtius – „durch den Dreck, die Ablagerungen und den Gedächtnisschwund der Jahrhunderte hindurch das ursprüngliche Bild der Dinge wiederzufinden: ihnen die Bedeutung wiederzugeben, die sie haben, solange wir ihnen nicht unsere Achtung entziehen“ (S. 17).
„Die Stunde der Schlangen“ ist nicht der einzige Band, den der Leser aus der Werkstatt dieses Autors in die Hand nehmen kann. Ebenfalls bei Noack & Block erschien „Die Wildgans. Geschichten aus Siebenbürgen“. Der Berliner Verlag erwarb von Langen/Müller (München) die Rechte für eine Neuauflage des 2011 zum ersten Mal veröffentlichten Buchs. Die neun Erzählungen sind nun, sprachstilistisch minimal überholt, in der insgesamt fünften Auflage erhältlich. Freuen dürfen wir uns zudem auf ein Bergel-Interview in Buchform unter dem Titel „Vom Abenteuer des Schreibens“ (im Erscheinen).
Christine Chiriac
Hans Bergel: „Die Stunde der Schlangen. Zehn Erzählungen“, Edition Noack & Block in der Frank & Timme GmbH, Berlin, 2022, 208 Seiten, gebunden, 20 Euro, ISBN 978-3-86813-078-2Hans Bergel: „Die Wildgans. Geschichten aus Siebenbürgen“, Edition Noack & Block in der Frank & Timme GmbH, Berlin, 2022, 170 Seiten, gebunden, 20 Euro, ISBN 978-3-86813-134-5
Schlagwörter: Hans Bergel, Rezension, Erzählungen
31 Bewertungen:
Noch keine Kommmentare zum Artikel.
Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.