5. Oktober 2025
Eine Forscher-Ära geht zu Ende: Mathias Beer im Ruhestand
Nach 35 Jahren am Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde in Tübingen wurde Dr. habil. Mathias Beer in den Ruhestand verabschiedet. Mathias Beer wurde 1957 in Hermannstadt geboren und besuchte dort das Pädagogische Lyzeum. Nach dem Wehrdienst studierte er zwei Semester Geschichte und Germanistik an der Universität Hermannstadt, um dann als Folge der Eheschließung mit der Bundesbürgerin Karla Polen, einer Banater Schwäbin aus Triebswetter, in die Bundesrepublik auszureisen. Hier setzte er sein Studium an der Universität Stuttgart fort.

Am Tübinger Institut entwickelte sich Beer zum international anerkannten Migrationsforscher mit dem Schwerpunkt auf Zwangsmigrationen und insbesondere der Flucht und Vertreibung der deutschen Bevölkerung am Ende des Zweiten Weltkriegs und den damit verbundenen Folgen. Davon zeugen seine 2018 in Klausenburg erfolgte Habilitation und ein beeindruckendes wissenschaftliches Werk, das bislang zehn Monografien, 20 Sammelbände, 252 Aufsätze und viele Tagungen umfasst. Hinzu kommen die Lehrtätigkeit an der Universität in Tübingen und die Gastprofessur an der Lucian Blaga Universität in Hermannstadt. Auf Breitenwirkung zielen seine umfangreiche Vortragtätigkeit sowie die mitorganisierten großen Ausstellungen, darunter „Fremde Heimat. Das Lager Schlotwiese nach 1945“ und die große Landesaustellung „IHR und WIR. Die Integration der Heimatvertriebenen in Baden-Württemberg“. Als anerkannter Migrationsforscher ist Beer Mitglied zahlreicher Beratungsgremien, u.a. der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin, und hat mehrere Fachkommissionen geleitet, darunter die Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa. Für seine Verdienste im Bereich der historischen Migrationsforschung wurde Beer 2017 mit dem Ludwig-Uhland-Preis ausgezeichnet. Die Banater Post nahm den Eintritt von Herrn Beer in den Ruhestand zum Anlass für ein ausführliches Interview, das der Bundesvorsitzende Peter-Dietmar Leber führte.
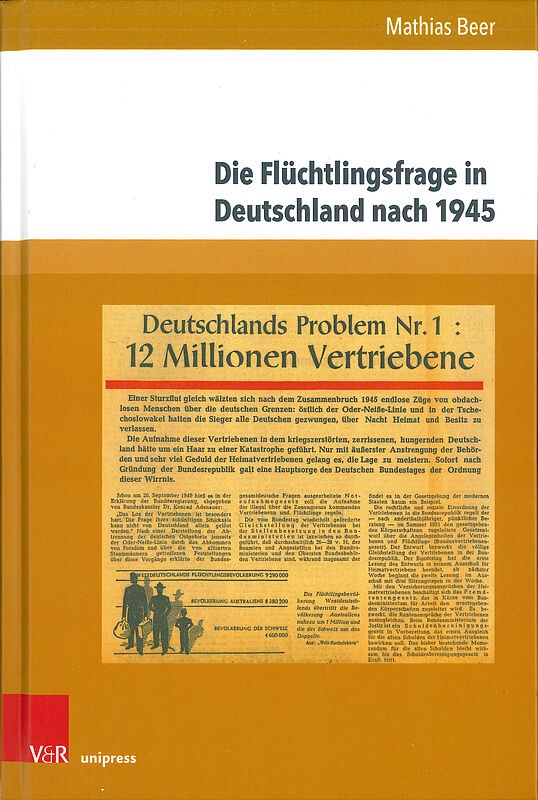
Flucht und Vertreibung der Deutschen am Ende des Zweiten Weltkriegs, eine wesentliche Folge der NS-Politik, sind nach wie vor die größte gewaltsame Bevölkerungsbewegung in der neueren europäischen Geschichte. Rund 12,5 Millionen Deutsche und Angehörige deutscher Minderheiten im östlichen Europa mit Hunderttausenden von Toten waren davon betroffen. Dabei sind, bezogen auf die Länder Südosteuropas, deutliche Unterschiede zu den Ostgebieten des Deutschen Reichs zu verzeichnen. Diese Zwangsmigration hatte globale Dimensionen. Sie veränderte Europa, führte Hunderttausende in alle Kontinente der Welt, und sie prägte Nachkriegsdeutschland nachhaltig. Die deutschen Vertriebenen stehen am Anfang der reichen Migrationsgeschichte der Bundesrepublik und bilden nach wie vor die größte Gruppe der hier lebenden Menschen mit Zuwanderungsgeschichte.
In vielen ihrer Studien haben Sie sich mit der Integration der Vertriebenen und Flüchtlinge im Allgemeinen und im Südwesten im Besonderen beschäftigt. Erfolgte die Eingliederung schnell und war sie erfolgreich, oder dauerte sie länger und gelang sie vielleicht nicht immer?
Das Beispiel der deutschen Vertriebenen, die zunächst trotz kultureller Nähe unwillkommen waren und als Fremde galten, zeigt, dass Eingliederung ein langer Prozess ist. Vergleichbar anderer Integrationsprozesse dauerte dieser auch bei ihnen drei Generationen. Dabei ist u.a. zwischen Alter, Herkunft und Ansiedlungsgebiet zu unterscheiden. Ältere Menschen kamen nie ganz in Deutschland an, weil sprichwörtlich „ein alter Baum schwer zu verpflanzen ist“. Vertriebene aus Ungarn hatten aufgrund ihrer schlechten deutschen Sprachkenntnisse größere Schwierigkeiten als andere Gruppen. Und im deutschen Südwesten war in den 1950er Jahren der Prozentsatz der Eheschließungen zwischen Einheimischen und Vertriebenen bundesweit am geringsten. Eingliederung kann, wenn der Staat klare Rahmenbedingungen schafft, zum wirtschaftlichen und kulturellen Vorteil der aufnehmenden Gesellschaft beitragen. Das zeigt die Aufnahme der deutschen Vertriebenen, es ist aber ein langer und steiniger Weg.
Es gibt viele Lebenserinnerungen von Donauschwaben, aus denen hervorgeht, dass die Flüchtlinge diesen Status schnell abstreifen wollten. Nur dort, wo sie zahlenmäßig sehr stark waren, z.B. in Stuttgart-Rot, traten sie gesellschaftlich als Gruppe auf. Sie haben auch dazu geforscht. Gibt es Parallelen zu anderen Zuwanderergruppen?
Neubürger möchten einerseits, und darin unterscheiden sich die deutschen Vertriebenen nicht von anderen Migrantengruppen, möglichst schnell in der neuen Gesellschaft ankommen. Andererseits suchen sie in der Fremde die Nestwärme der Landsleute und tragen ihr kulturelles Gepäck mit sich. Das erlaubt es ihnen, sich in der neuen Umgebung zu behaupten. In der Forschung spricht man von einem Identitätsanker. Er bietet Halt und findet seinen Ausdruck im Freundes- und Bekanntenkreis, in einem bestimmten Dialekt, einer bestimmten Küche usw. Und dieser Anker entfaltet seine Wirkung über Generationen. Die Folge: Man wird zwar nach und nach Einheimischer, versucht aber, sich mit seinen kulturellen Merkmalen als besondere Gruppe zu behaupten – als Banater Schwaben zum Beispiel.
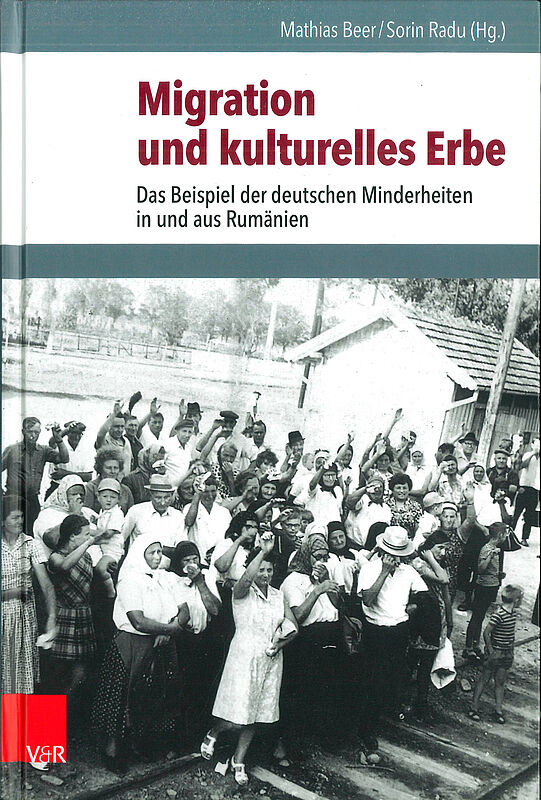
Heimatbücher sind eine vergleichsweise neue Buchgattung. Sie entstand erst Anfang des 20. Jahrhunderts. Heimatbücher sind immer eine Antwort auf sich rasant verändernde Lebensbedingungen oder auf die Trennung vom Heimatort. So erklären sich die Konjunkturen des Heimatbuchs an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, in den 1970er Jahren und auch gegenwärtig. Unter solchen unsicheren Bedingungen werden Heimatbücher verfasst, werden neu aufgelegt oder erscheinen in einer neuen, erweiterten Auflage. Heimatbücher sind in diesem Sinn Ausdruck lebendiger Heimatortsgemeinschaften. Ihre wichtige Rolle im Eingliederungsprozess wird nach wie vor unterschätzt. Die Geschichte der HOGs – ein lohnendes Unterfangen – ist aber nicht Gegenstand eines Heimatbuchs. Sie sollte, solange noch Zeitzeugen und Unterlagen vorhanden sind, archiviert und unbedingt festgehalten werden.
In einem Kooperationsprojekt mit rumänischen Kolleginnen und Kollegen sind Sie der Frage nach dem Verhältnis von Migration und kulturellem Erbe bei den deutschen Minderheiten aus Rumänien nachgegangen. Welches sind einige Ergebnisse des 2024 daraus entstandenen Bandes?
Migrationen verändern Herkunftsgesellschaften, und sie verändern die Ankunftsgesellschaften. Dafür bieten die deutschen Minderheiten in und aus Rumänien ein lohnendes Forschungsthema. Denn mit der fast vollständigen Ausreise der Banater Schwaben und Siebenbürger Sachsen im Rahmen einer Kettenmigration, die 1990 ihren Höhepunkt erreichte, stellt sich die grundlegende Frage nach den Erben des kulturellen Erbes in doppelter Hinsicht neu. Zum einen vervielfachte sich die Zahl der Erben. Zum rumänischen Staat, seinen Archiven, Bibliotheken und Museen sowie der katholischen und evangelischen Kirche kamen vergleichbare Einrichtungen in der Bundesrepublik hinzu. Sie bewahren und erforschen, wie das IdGL, dieses Erbe. Zum anderen zeigt sich, dass das Kulturelle der deutschen Minderheiten in Rumänien nicht nur in Form von Architektur fortwirkt, sondern sich auch im Alltag weiterentwickelt. Es entstehen neue Ausdrucksformen, in denen sich das deutsche kulturelle Erbe widerspiegelt, zum Beispiel in den Nachbarschaften, in der Übernahme von Speisen usw. Die Geschichte der deutschen Minderheiten findet also in Abwesenheit einer deutschen Bevölkerung eine spezifische Fortsetzung in Rumänien.
Neben Ihrer Forschung, Lehrtätigkeit und Öffentlichkeitsarbeit haben Sie insbesondere als langjähriger Geschäftsführer des Instituts mit dazu beigetragen, aus der Idee, die schon 1954 entstanden ist, ein anerkanntes Institut der deutschen Südosteuropaforschung zu entwickeln. Ein Institut aufzubauen und in der Welt der Wissenschaft zu verankern, zu vernetzen, ist sicher nicht einfach?
Nein, einfach war es nicht, aber lohnend, weil ich an entscheidender Stelle und unterstützt von den Kolleginnen und Kollegen daran mitarbeiten durfte, etwas zu gestalten und zu entwickeln, das in dieser Form einzigartig ist – das Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde in Tübingen. Als das Land Baden-Württemberg im Rahmen seiner Patenschaft über die „Volksgruppe der Donauschwaben“ 1987 das Institut gründete, war es in einer Dreizimmerwohnung in der Tübinger Südstadt, in der Paulinenstraße, untergebracht und startete mit zwei Forschungsprojekten. 1992 erfolgte der Umzug in das Institutsgebäude in der Mohlstraße, in Sichtweite der Universität, mit der das Institut eng zusammenarbeitet. Das Gebäude wurde gleich grundlegend saniert und gerade erst wieder ansprechend renoviert. Parallel dazu galt es, die wissenschaftlichen Strukturen zu schaffen, auf deren Grundlage der Gründungsauftrag umgesetzt werden konnte. Meinen Überlegungen folgend, erhielt das Institut fünf bis heute bestehende interdisziplinär ausgerichtete Forschungsbereiche. Eine Bibliothek, Sammlungen (Karten, Fotos, Postkarten) und ein Archiv vervollständigen den Dokumentationsauftrag. Mit der Übernahme der Geschäftsführung ist es mir mit der Institutsleitung gelungen, den international besetzten Wissenschaftlichen Beirat neu auszurichten und das Forum Landsmannschaft als institutionalisierte Austauschplattform mit den donauschwäbischen Landsmannschaften aus der Taufe zu heben. Schließlich habe ich mit den drei M – Migration, Minorities, Memories – das wissenschaftliche Leitbild des Instituts entwickelt. Das Institut steht für die Erforschung der Migrationen nach und aus Südosteuropa vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, die Geschichte der deutschen Minderheiten in der Region und die Art und Weise, wie gesellschaftlich und wissenschaftlich an diese Migrationen und Minderheiten bis in die Gegenwart erinnert wird.
Wie gestaltete sich der Aufbau der Bibliothek und des Archivs am Institut? Wie umfangreich sind die Bestände? Welchen Stellenwert hat die Digitalisierung?
Bei seiner Gründung verfügte das Institut über kein einziges Buch und kein einziges Aktenkonvolut. Heute umfasst der Bibliotheksbestand des Instituts über 40000 Einheiten (Bücher und Zeitschriften) in allen gängigen Sprachen, selbstverständlich auch den Sprachen der Region. Sie sind erschlossen, manche auch als Digitalisate, und auch über den elektronischen Katalog der Universitätsbibliothek weltweit recherchierbar. Das Archiv hat mittlerweile einen Umfang von 160 laufenden Meter erreicht. Es speist sich im Wesentlichen aus Schenkungen und verfügt über eine über das Internet zugängliche Bestandsübersicht. Mit seiner Bibliothek und seinem Archiv ist das Institut weltweit betrachtet die zentrale Einrichtung, in der das donauschwäbische Gedächtnis dokumentiert und erschlossen wird. Alle Landsleute können durch Schenkungen mit dazu beitragen, dieses weiter anzureichern.
Im Archiv des IdGL befindet sich auch die Altregistratur unserer Landsmannschaft bis 1989, abgesehen von einigen Ordnern zu den Bereichen Familienzusammenführung und Bundesvorstand, die noch in der Bundesgeschäftsstelle verwahrt werden. Wie werden die Bestände von der Forschung genutzt?
In dieser Hinsicht ist die Landsmannschaft der Banater Schwaben ein leuchtendes Vorbild unter den donauschwäbischen Landsmannschaften, hat sie doch bisher als einzige ihre Unterlagen an das Archiv des Instituts abgegeben. Diesem Beispiel sollten auch die Heimatortsgemeinschaften folgen, deren Bestände im Zusammenhang mit der Auflösung einiger HOGs verlorenzugehen drohen. Das Archiv des Instituts ist ein öffentliches Archiv. Es sichert die Grundlage, die es Interessierten (Studenten, Forschern, Laien) erlaubt, quellengestützt an ihren Themen forschen zu können. Dabei werden sie von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Instituts unterstützt.
Das IdGL ist national und international in Forschung und Lehre vernetzt. Was kann man sich darunter vorstellen?
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts unterrichten an unterschiedlichen Fakultäten der Universität Tübingen, aber auch an Universitäten in Rumänien, Ungarn und Serbien. In diesem Rahmen betreuen sie Abschlussarbeiten und Dissertationen, auch über donauschwäbische Themen. Eng damit verbunden sind themengebundene Kooperationsprojekte mit Universitäten und Forschungseinrichtungen in den Ländern Südosteuropas, die Tagungen, Publikationen und Studentenaustausch verbinden.
Sie sind zwar in Siebenbürgen geboren, aber kein Siebenbürger Sachse, sondern ein Landler. Wer sind diese und was zeichnet diese Gruppe aus?
Im 18. Jahrhundert stellten die Habsburger Kaiser die Untergrundprotestanten vor die Wahl: Entweder zum katholischen Glauben zurückzukehren oder aber deportiert zu werden. Die Mehrheit der Betroffenen entschied sich, protestantisch zu bleiben. Sie wurden in drei Etappen unter Karl VI., Maria Theresia und Joseph II. unter militärischer Aufsicht nach Siebenbürgen deportiert. Ein Teil der entsprechenden Unterlagen befindet sich übrigens in den Banatica-Akten des Haus- Hof- und Staatsarchivs in Wien. Weil sie „einer Nation und eines Glaubens“ waren, nahm man an, sie würden von den evangelischen Siebenbürger Sachsen schnell assimiliert. Das Gegenteil war der Fall, denn sie sprachen nicht einen siebenbürgischen Dialekt, sondern deutsch, sie waren anders gekleidet, hatten ein anderes Arbeitsethos und wurden als Fremde abgelehnt. Unter diesen Umständen entwickelten die aus dem Salzkammergut, der Steiermark und Kärnten stammenden Transmigranten, wie sie zeitgenössisch genannt wurden, in Siebenbürgen in drei Orten nördlich von Hermannstadt – Neppendorf, Großau, Großpold – ein eigenes, jeweils lokal geprägtes Gruppenbewusstsein als Landler. Zu den Deportationen des 18. Jahrhunderts, zu denen auch die Temeswarer Wasserschübe gehören, bei denen regelmäßig Außenseiter aus Wien ins Banat deportiert wurden, bereite ich gerade einen Band vor.
Sie treten nun ihren wohlverdienten Ruhestand an. Aber wer 40 Jahre lang als Historiker mit Herzblut geforscht hat und ein passionierter Sammler historischer Karten ist, wird ja im 41. Jahr nicht damit aufhören. Auf was können wir uns freuen, welche Vorhaben stehen an, mit welchen Arbeiten werden Sie uns überraschen? Fällt Ihnen der Abschied vom Institut schwer?
Mein Abschied ist eine doppelte Zäsur, für das Institut und für mich. Ich verlasse das Institut mit einem gutem Gewissen, weil ich es in guten Händen weiß. Die Kolleginnen und Kollegen werden auf bewährten Pfaden neue Wege gehen, ihre Spuren hinterlassen. Für mich ist es ein großer Einschnitt in meinem Leben. Aus dem IdGL, dem ich viel zu verdanken habe und das ich geprägt habe, nehme ich tatsächlich einige Ideen und Projekte mit. Ich hoffe auf weiterhin gute Gesundheit, die Voraussetzung, damit einige davon reifen können. Noch wichtiger ist aber die nun verfügbare Zeit für die Familie, die Enkeltochter Laura, den Hund Samy und für weite Laufstrecken, die mich entspannen. Das Leben nimmt nun einen neuen Lauf, auf den ich mich ohne Wehmut sehr freue.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Beer, und alles Gute weiterhin für Sie und Ihre Familie.
(leicht gekürztes Interview aus der Banater Post vom 15. September 2025)
Schlagwörter: Interview, Landler, Wissenschaftler
43 Bewertungen:
Noch keine Kommmentare zum Artikel.
Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.