23. Juli 2021
300 Jahre seit der Geburt von Samuel von Brukenthal (1721-1803): Festvortrag von Thomas Șindilariu am Digitalen Heimattag 2021
Samuel von Brukenthal gehört zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der siebenbürgisch-sächsischen Geschichte. Warum eigentlich? Mit einem Begriffspaar, wie etwa bei Johannes Honterus und Reformation, will die Antwort nicht gelingen. Komplex und teils verwirrend, ganz so wie unsere Gegenwart, war auch die Lebenszeit von Samuel von Brukenthal – seine Lösungen und Antworten waren aber originell! Eines jedoch verbindet beide Persönlichkeiten: Sie sind ohne Zweifel deshalb bedeutend, weil sie unseren siebenbürgischen Winkel Europas näher an das Zentrum des Kontinents gerückt haben. Ihr Engagement, und das gilt es zu unterstreichen, ist keines gewesen, das sich auf die siebenbürgisch-sächsische Gesellschaft allein beschränkt hat, sondern es berücksichtigte alle Völkerschaften Siebenbürgens, selbstverständlich auch unter Einschluss der heutigen rumänischen Mehrheitsbevölkerung. Am 26. Juli 1721 wurde Samuel Breckner (von Brukenthal) in Leschkirch geboren.

Gediegene Ausbildung und weitgespannte Vernetzung Grundlage des Erfolgs
Ein Adliger also! Wie passt das zu der auf Rechtsgleichheit fußenden siebenbürgisch-sächsischen Autonomie im historischen Siebenbürgen? Georg Scherg hat ihren Inhalt so treffend in dem Buchtitel „Da keiner Herr und keiner Knecht“ zusammengefasst. Die Brukenthals waren nicht die einzigen Sachsen mit Adelstitel, die mütterliche Verwandtschaft aus der Familie Conrad von Heydendorff und viele andere wären hier zu erwähnen.
Aus den jährlichen Steuerverzeichnissen von Freck und Hermannstadt, die aus dem 18. Jahrhundert in beträchtlicher Konsistenz für übrigens fast jeden sächsischen Ort, Hof für Hof, Eigentümer für Eigentümer in den Staatsarchiven erhalten sind, kann man entnehmen, dass Brukenthal keinerlei steuerliche Vorteile genoss, sondern einer der größten Steuerzahler gewesen ist – so zahlte er in Hermannstadt 1790/91 stattliche 93 fl. (Gulden).
Eine überdurchschnittlich gute Vernetzung und eine solide Ausbildung waren die nächsten beiden Voraussetzungen für den atemberaubenden Erfolg Brukenthals. Er war in der Lage, in beides gezielt und entschlossen investieren zu können, da er auf das ihm als Jüngstem zustehende väterliche Erbe verzichtet hatte und sich als erst 22-Jähriger hatte auszahlen lassen infolge des frühen Todes beider Eltern. Noch ehe er seinen Studienort Halle an der Saale erreicht hatte, ist er 1743 in Wien unter den Mitgliedern der dortigen neu gegründeten Freimaurerloge „Aux Trois Canons“ zu finden. Wie er es hinbekommen hat, den Anschluss an diese Kreise zu finden, die dem Umfeld von Franz von Lothringen, dem Gemahl von Maria Theresia, zugeschrieben wurden, das wüsste ich nur zu gerne im Detail! Fakt ist, dass wir ihn hier wie aus dem Nichts inmitten einer Gesellschaft wiederfinden, die sich der Ideale der Humanität und Aufklärung verpflichtet fühlte und zudem zur geistigen Elite des gesamten Reiches zu zählen war. In Halle war Brukenthal ebenfalls als Freimaurer aktiv und gründete und leitete die Loge „Zu den drei Schlüsseln“. Diese war eine Tochterloge der Berliner Loge „Zu den drei Weltkugeln“, die dem Umfeld des Preußenkönigs Friedrich des Großen zugeordnet wurde. Es soll sich sogar eine Begegnung zwischen Brukenthal und dem Alten Fritz zugetragen haben, wobei dieser versucht haben soll, Brukenthal in seine Dienste zu übernehmen. Brukenthal lehnte jedoch unter Hinweis auf seine Treue zur Monarchin und seine Heimatliebe ab, was nicht ohne Eindruck blieb.

Das Selbstbild des jungen Brukenthal mit deutlichem Nachwirken bis an sein Lebensende bringt die Gedenkmedaille zum Ausdruck, die er als Vorsteher der Hallenser Loge 1744 prägen ließ. Die Initialen „C.S. v. BR.“ stehen für seinen vollständigen Namen Carl Samuel von Brukenthal, die Umschrift „Studio, Sapientia, Silentio“, also Streben bzw. Fleiß, Weisheit, Ruhe bzw. Verschwiegenheit können als authentisches Lebensmotto angesehen werden. Der Brukenthal zugeschriebene Wahlspruch „Fidem genusque servabo“ ist zwar zutreffend, der Beleg, dass der Spruch von Brukenthal selbst stammt und nicht das Werk seines ersten Biographen ist, ließ sich noch nicht ausfindig machen. In älterer, freier Interpretation lautet er „Meinem Glauben und meinem Volk will ich treu bleiben“, treffender ist aber „Der Treue bzw. dem Glauben und dem Volk will ich dienen“. „Studio, Sapientia, Silentio“ ist aber gewiss authentisch.

Zurückgekehrt nach Hermannstadt heiratete er Sophia von Klocknern (1725-1782). Eine glückliche Ehe schloss sich an, die allerdings vom Tod des einzigen Kindes, Sophia (1748-1752), im Alter von nur vier Jahren stark getrübt wurde. Sophia brachte als Tochter des Provinzialbürgermeisters Daniel Klockner von Klocknern auch ein erhebliches Vermögen in die Ehe ein, das einen unerlässlichen Grundstein für den weiteren Aufstieg Brukenthals darstellte – die Studienzeit und die Investitionen in ein europaweit gespanntes Bekanntschafts- und Freundschaftsnetzwerk hatten Brukenthal ein Vermögen gekostet. Über ihn hieß es bei seiner Rückkehr: „Er kam aus Deutschland als ein von Wissenschaften und Cultur glänzender junger Mann, eine Schönheit eines Mannes, nach Hermannstadt zurück, aber außer sich mit keinen anderen Mitteln.“ Neid für das Erreichte, teils von unvorstellbar primitiver Art, sollte folglich ein dauerhafter Begleiter von Brukenthals Lebensweg werden.
Auf den Sprossen der Karriereleiter bis zum Gubernator
Die ersten Jahre Brukenthals im Dienste der Verwaltung der Sächsischen Nation seien hier nur erwähnt. Es soll hier vielmehr der Gesamtkontext seines beruflichen Erfolges bis ins höchste Amt der Provinzialverwaltung, des Gubernators (1777-1787), skizziert werden.Die Karriere von Samuel von Brukenthal kann auch als ein lang anhaltendes Durchsetzen des meritokratischen Leistungsprinzips in einer Welt der höfischen und bürokratischen Intrigen betrachtet werden. Freilich, Erfolg hierbei ist auf Partner angewiesen, die desgleichen dem meritokratischen Prinzip verpflichtet sein müssen. Brukenthal hat in dieser Hinsicht vor allem eine Partnerin gehabt, die Thronerbin selbst, Kaiserin Maria Theresia (1717-1780). Anders als ihre Söhne und Nachfolger verfügte sie über die Gabe, sich ein Netzwerk von fähigen, langjährigen Mitarbeitern zu bilden. Die Treue der Elite aus der Entourage von Maria Theresia war von einer Art, die weit jenseits ökonomischer Abhängigkeit oder gar Furcht vor der Kaiserin stand, vielmehr handelte es sich hierbei um partnerschaftliche Beziehungen, die auf gegenseitigem Vertrauen fußten. Dem historischen Forschungsstand gemäß war das solchermaßen geknüpfte Netzwerk von überaus großer Bedeutung, was den erfolgreichen Zusammenhalt und die Bekämpfung der wahren Probleme des Länder- und Provinzenkonglomerats der Habsburgermo- narchie anbelangt. Einer Monarchie, die übrigens eine sehr kritische Phase durchlief, als Brukenthal 1753 in direkte Verbindung zu Maria Theresia trat. Dies gelang ihm binnen weniger Tage nach seiner Ankunft in Wien – Delegationen anderer brauchten oft mehrere Monate, bis eine Audienz beim Herrscher zustande kam. Als Erklärung dafür werden neuerdings die Kontakte Brukenthals gesehen, die er bereits 1743 bei seinem ersten Wienaufenthalt geknüpft haben dürfte.
Das heute in Polen liegende Schlesien, rund um die Stadt Breslau/ Wrocław, zählte im 18. Jahrhundert zu den produktivsten und ertragreichsten Provinzen der Habsburgermonarchie. 1740 war es vom König Preußens, Friedrich dem Großen, erobert worden. Der sich anschließende Konflikt währte in mehreren Etappen bis zum Ende des Siebenjährigen Krieges 1763 und hat die Habsburgermonarchie in die Nähe des vor allem finanziellen Zusammenbruchs getrieben. Der Verlust Schlesiens kann ohne Weiteres mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU verglichen werden. Die östlichen Provinzen der Habsburgermonarchie rückten folglich verstärkt in das Blickfeld der Wiener Regierung. Tiefgreifende Reformen und tatsächliches Know-how zur Begegnung der Krisen waren erforderlich.

Brukenthal war im Übrigen in die Gegenmaßnahmen zum Abfangen der Folgen der genannten Geometrischen Proportion auf kirchlichem Gebiet einbezogen. Angesichts der nicht mehr gegebenen konfessionellen Einheitlichkeit der Stadträte, die auch für Kirchenfragen und vor allem das Kirchenvermögen weitgehend zuständig waren, wurde der erste Anlauf zur Einführung einer von der politischen Verwaltung unabhängigen konsistorialen Kirchenverfassung 1754 unternommen. Brukenthal war hintergründig involviert, um das neue System zum Laufen zu bringen. Die damals eingeführten Grundprinzipien sind auch heute noch in der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien zu finden.
Ausnahmen bestätigen auch in Sachen Konfessionswechsel die Regel. Einige wenige gab es, wenn es um prägende Figuren des zentralen Beamtenapparates ging, die eine universitäre Bildung von außerhalb der Monarchie vorweisen konnten und dadurch für den Reformprozess der Habsburgermonarchie unverzichtbar waren. Es ging darum, die finanziellen Probleme des Staates durch Reformen zu lösen, um in militärischer Hinsicht standhalten zu können, was enorme Summen erforderte. Dies war der Kontext, in dem es Brukenthal wagen konnte, letztlich mit Erfolg, eine dieser Ausnahmen zu sein und als hoher Beamter seinen evangelischen Glauben beizubehalten. Als man von ihm 1762 die Konvertierung erwartete, im Moment, als er die Leitung der Siebenbürgischen Hofkanzlei übernahm, gab er der Kaiserin zur Antwort, wie es denn möglich sein könne, von ihm den Konfessionswechsel zu erwarten als ein Zeichen der Loyalität, wo doch die Konfessionsangehörigkeit eines der intimsten Dinge im Leben eines Menschen sei, von der, einmal abgefallen, man auch sonst schwerlich treu sein könne.
Erfolgreicher Reformer
Die bedeutendste Reform, die Samuel von Brukenthal für Siebenbürgen umsetzen konnte, war die Einführung eines neuen Steuersystems. Es handelt sich dabei um eine Kombination aus Kopf- und Grundsteuer. Das reformierte Steuersystem steigerte das jährliche Steuereinkommen Siebenbürgens nach seiner endgültigen Einführung 1770 um 1350802 fl. (Gulden). Damals konnte man für etwa 2000 fl. in Hermannstadt ein stattliches Haus in bester Lage erwerben. Brukenthal erhöhte demnach die Steuereinnahmen in Siebenbürgen um den Gegenwert von 675 Bürgerhäusern – fast eine ganze Stadt!1774 wurde Brukenthal der Vorsitz des Guberniums von Siebenbürgen, also der obersten Verwaltungsbehörde mit Sitz in Siebenbürgen, damals in Hermannstadt, anvertraut. Das Gubernium war das Pendant der Siebenbürgischen Hofkanzlei in Wien, die Brukenthal bis dahin geleitet hatte. 1777-1787 bekleidete er auch förmlich als Gubernator dieses höchste öffentliche Amt in Siebenbürgen – freilich auch das bestbezahlte.

Soweit die politische und administrative Karriere Samuel von Brukenthals, doch er war weit mehr als das. Die Habsburger, wie jedes andere Herrscherhaus, waren bestrebt, auch in entfernt vom Zentrum liegenden Territorien eine treue Anhängerschaft oder Elite zu bilden. Dass diese Bemühungen auch dazu gedacht waren, in die Gesellschaft auszustrahlen, dafür dürfte Brukenthal eines der besten Beispiele sein.
Initiator des institutionalisierten Kulturerbegedankens – das erste öffentliche Museum Südosteuropas
Brukenthal verstand es, den ihm zuteilwerdenden Reichtum im Sinne des Allgemeinwohls einzusetzen – mit 18000 fl. Jahresgehalt hatte ihm die Kaiserin als Gouverneur etwa das Doppelte des im Rang zweiten Gubernialrats zugesprochen. Der erreichte gesellschaftliche Repräsentationsstatus machte es ihm möglich, für Siebenbürgen in Wien von gleich zu gleich aufzutreten. In der Provinz nützte er seinen Wohlstand jenseits von dienstlichen und privaten Repräsentationszwecken, die gleichermaßen aus dem Gehalt bestritten werden mussten, insbesondere auch, um die Allgemeinheit in Hinblick auf die wirtschaftliche, landwirtschaftliche und kulturelle Belange zu fördern.An erster Stelle sind hier seine bedeutenden Sammlungen zu nennen, die enorme Summen verschlungen haben, Bücher, Handschriften, Münzen, Gemälde, Graphik etc. In der Zeitspanne 1764-1803 gab er insgesamt 62181 fl. nur für Anschaffungen aus, davon allein 43283 fl. für Bücher! In das oben gebrauchte Bild erneut heranzuziehen: seine Anschaffungskosten entsprachen dem Gegenwert von 31 Bürgerhäusern! Die Hochphase dieser Ausgaben fiel in Brukenthals letzte 15 Lebensjahre, als er mit zu Unrecht erlittenen Rentenkürzungen zu kämpfen hatte. In diesem Zeitabschnitt dürfte der Gedanke zum Entschluss gereift sein, der Nachwelt eine gut ausgestattete Institution zu hinterlassen, die zur Hebung der Kultur der Allgemeinheit auf lange Sicht beitragen möge. Für die Umsetzung seines Willens fand er über sein Testament einen rechtlich originellen Weg, der all sein juristisches Wissen erkennen lässt. Er legte nicht nur die Unteilbarkeit seiner Vermögensmasse fest und setzte einen bestimmten Familienzweig als Nutznießer ein, solange er männliche Erben hatte, sondern verpflichtete dazu, seine Sammlungen der Allgemeinheit bereits nach seinem Tod zugänglich zu machen.

Bodenständiger Kosmopolit
Das wirtschaftliche Denken Samuel von Brukenthals verrät seine bäuerliche Herkunft, für die er sich gewiss nicht schämte. Weltgewandte Repräsentation und die Pflege des siebenbürgisch-sächsischen Dialekts in all seinen Häusern waren kein Widerspruch, sondern Normalität. Desgleichen schätzte er die Tracht der Menschen, wie mehrfach belegt ist – Ansätze einer originellen Verbindung von Tradition und Moderne lassen sich da erkennen, über die man nachdenken sollte, auch heute.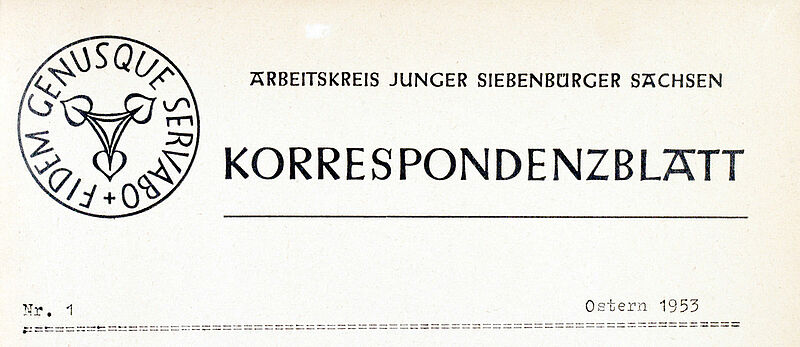

Ein Vermächtnis von Aktualität mit vielfachen Anknüpfungspunkten
Abschließend kehre ich zur Eingangsfrage nach dem kollektiven Orientierungswert des Lebens und Wirkens von Samuel von Brukenthal zurück. Der mit Abstand am meisten beeindruckende Aspekt ist für mich: Mit enormem Wissensdrang und Arbeitseifer gelang ihm ein atemberaubender Aufstieg vom Sohn des Königsrichters, also des Bürgermeisters eines recht abgelegenen bäuerlichen Marktfleckens, zum Landeschef in Stellvertretung des Monarchen. Seine Herkunft hat er bei aller Aufgeschlossenheit gegenüber den modernen Geistesströmungen nie geringgeschätzt, ganz im Gegenteil! Er hat die Zukunftstauglichkeit der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaftsstrukturen früh erkannt, ihren Wandel immer wieder gefördert und sein Wirken auf Landesebene um diesen Grundaspekt herum aufgebaut, letztlich zum Vorteil aller Völker Siebenbürgens.
Thomas Șindilariu
Schlagwörter: Brukenthal, Jubiläum, Leschkirch, Hermannstadt, Freck, Brukenthalmuseum, Habsburg, Maria Theresia, Wien, EU, Klaus Johannis
34 Bewertungen:
Neueste Kommentare
- 03.08.2021, 12:50 Uhr von Rainer Lehni: Das Problem mit dem Status des Brukenthalmuseums ist bei allen relevanten Stellen bekannt. An der ... [weiter]
- 28.07.2021, 07:55 Uhr von Peter Otto Wolff: Hallo Robert, ich glaube kaum, dass den Veranstaltern das Problem nicht bekannt war. Vielmehr ... [weiter]
- 25.07.2021, 23:30 Uhr von Robert: Mir fehlt in diesem Festvortrag eine Aussage über den Status des Brukenthalmuseums bzw. die ... [weiter]
Artikel wurde 3 mal kommentiert.
Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.