21. Oktober 2025
Ins Füllhorn gestoßen: Eginald Schlattners Roman „Die dritte Nacht“
Eginald Schlattner hat einen schmalen Roman geschrieben. Wollte man das auf Altersweisheit zurückführen, täte man ihm Unrecht. Denn zum einen hat der Romancier zwar spät debütiert, dafür mit einer Wucht, dass er den Gedanken an sein Lebensalter stets in den Hintergrund zu drängen vermochte. Zum anderen hat er immer schon auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen können, der in einer nahezu paradigmatisch siebenbürgischen Kindheit und Jugend sowie in einer so frühen wie schmerzlichen Auseinandersetzung mit dem rumänischen Stalinismus und Sozialismus begründet liegt. Dass spezielles Wissen und umfassende Bildung sich zur Weisheit geläutert hätten, das hat er nicht zugelassen, erzählt hat er von alledem mit einer Verve, die auch heute nicht nachlässt.
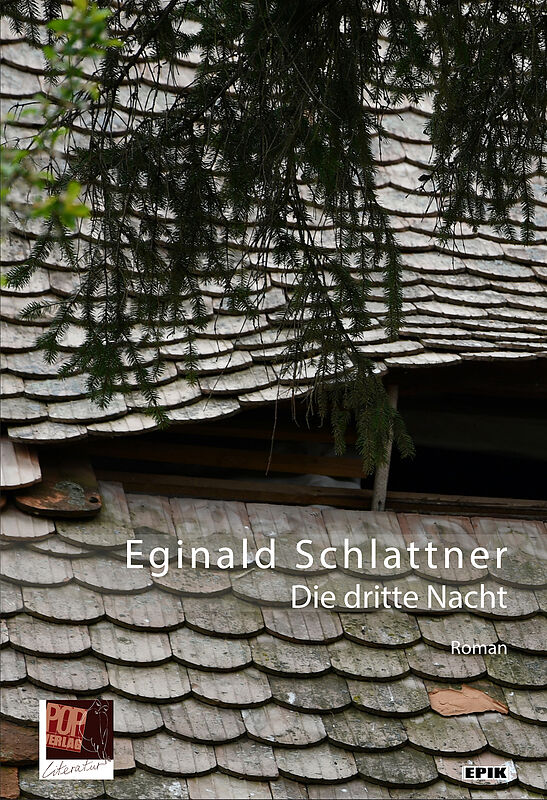
Eine zarte Liebesgeschichte bahnt sich an, während die Zeitgeschichte den Protagonisten mitspielt, alles andere als zart. Im Strudel der Nachkriegsjahre geht auch Siebenbürgen unter, eine vielfältige und einzigartige Gemeinschaft wird zerschlagen, eine deutsche Familie schlägt sich notdürftig durch, was man neuerdings „Klassenkampf“ nennt, sind die bösartigen Urständ, die historisch gewachsener Frust, Hass und Missgunst feiern. Die Fortführung des Krieges mit den Mitteln der Niedertracht erfasst die Menschen aus der Donautiefebene über die Karpaten hinweg bis in die Ukraine – und in einer als „Rattenburg“ bezeichneten Notunterkunft in Fogarasch rätseln angehende Abiturienten bei einem „Teekesselspiel“ über weit mehr als das Lösungswort. Denn jetzt, wo man nichts mehr hat, geht es immer um alles.
Den Part der ebenso einfühlsamen Wissenden in Sachen Liebe wie klipp und klar, ja harsch Formulierenden in Sachen Zeitgeschehen hat dabei eine Gestalt, in der sich all das üppig wuchernde Pittoreske und faszinierende Hörensagen bündelt, mit denen eine Kulturlandschaft wie die von Schlattner imaginierte gesegnet ist. Diese Anastasia alias Yvonne ist ein Findelkind mutmaßlich adligen Geblüts (burgenländisch oder gar phanariotisch?). Sie scheint nicht nur allerhand um Geschlecht und jugendliches Begehren zu wissen, sondern auch um ihre „enigmatische“ (S. 57) Herkunft mehr, als die Nachforschungen des Ich-Erzählers und seiner Malytante ergeben. Sogar der „Siebmacher mit rund 137000 Familiennamen und Adelsprädikaten“ (S. 28) und der verbannte rumänische Fürst Sturdza als mögliche Gewährsperson zum Themenkreis „La noblesse et éternité“ werden zu Rate gezogen. Das alles ist so reizvoll, wie es rätselhaft bleibt – der Autor ergeht sich nachgerade genüsslich in historischen Ränke- und sprachlichen Rankenspielen, der Leser darf mitspielen.
Vermeintlich dezidierte Klarheit schafft die Geheimnisträgerin erst nach gut einem Drittel des Buches: „Zwölf Kinder werde ich haben wie meine Urgroßmutter, die mannstolle Baronin …“ (S. 68) Bis dahin hat Eginald Schlattner weidlich Gelegenheit gehabt und Anlass genommen, landschaftstypische Spezifika ins schillerndste Licht zu rücken. Behutsam, doch mit beiden Händen greift er in seinen Fundus an Historie, Landeskunde und anekdotisch gewürztem Bildungsgut. Ob stalinistische Verheerungen oder Partisanenkampf, ob Rainer Maria Rilke oder Adolf Meschendörfer oder gar „Muss i denn“, ob Orientteppich oder fürstliche Heraldik, vielfältigste Ingredienzien südöstlicher Exotik und Früchte der Erziehung in einem gutbürgerlich sächsischen Milieu, das jetzt der Diktatur des Proletariats ein Schnippchen zu schlagen versucht, werden bedenkenlos beherzt gemischt zu einem Cocktail, den man ebenso bedenkenlos als süffig bezeichnen darf.
Dann wird es ernst, beinahe auch mit der Liebe. Anastasia alias Yvonne und der Ich-Erzähler fahren mit „biciclete“ ins Abendlicht, beim Hofbauern Nene Dumitru Milch holen und die bäuerlich rumänische Facette jener Lebenswelt erkunden, gegen deren Untergang die Partisanen von den Karpaten herab kämpfen. Aus jener Welt sind diese erwachsen und werden von ihr getragen. (Der Ich-Erzähler hat am Katafalk eines von ihnen erschossenen Milizionärs, der im enteigneten Ladenlokal seines Vaters aufgebahrt war, Ehrenwache halten müssen! „Der einzige Sachse, dazu im eigenen Geschäft. Du kannst dir nicht vorstellen, wie elend mir zumute war. Zum Kotzen.“ – S. 77) Die erotische Spannung gedeiht beim Bad an einer Mühle, die politische wiederum beim Gespräch mit den verbitterten Bauersleuten. Das urtümliche Ambiente und die rumänischen Vokabeln sorgen für Kolorit: „‚Mulţumesc pentru masă, sărut mâna!‘ Danke für das Essen, küss die Hand! Sagten es, taten es nicht. Ich verbeugte mich bloß, Yvonne aber umarmte beide und küsste sie auf die Wangen, die Hausmutter, den Hausvater. Das gefiel allen.“ (S. 108) Solche Lakonik ist bei all der epischen Schwelgerei umso willkommener.
Nun schafft es der Meister erzählerischer Opulenz in gekonnt ausgespielter Widersprüchlichkeit, retardierende Ereignisse sich fatal überstürzen zu lassen. Fahrradtechnisches Missgeschick und viehtreiberisches Ungeschick vereiteln schließlich jene von Yvonne beschworene „dritte Nacht“. Es geschehen die tollsten Sachen, damit nichts geschieht. Sie geben jedoch auch wieder Raum für Exkurse über das pervertierte gesellschaftliche Gefüge. Neben einem störrischen Büffelochsen als Diabolus ex Machina treten als Zeugen auf: ein zum „Genossen“ arrivierter Knecht, ein Zigeuner und „trotzdem ein Chef“ (S. 125) mit einem historisch-kritischen Loblied auf die Sachsen, ein sächsischer Pfarrer, der mit einem „Sermon“ (S. 156) über die jüngste Barbarei seinem Namen Arnold Wortmann alle Ehre macht.
Gewährt wird ein grotesk erotisch getönter, gelinde verstörender Einblick in die Sittenlosigkeit der neuen Machthaber, die wiederum Pfarrer Wortmann kulturhistorisch einordnet: Sie schrecken nicht davor zurück, mit ihren „Orgien“ den Schreibtisch zu profanieren, „an dem unser Dichterfürst Erwin Wittstock seinen prophetischen Roman geschrieben hat: Bruder, nimm die Brüder mit“ (S. 159). Ein von dem Wrack eines deutschen Panzers stammendes „Balkenkreuz“ taucht auf und unter, die Russland-Deportation der Rumäniendeutschen wird als Memento beschworen.
Ein schmaler und schwellender Roman also, der nicht nur einer mutmaßlichen Schlattner-Gemeinde behagen dürfte. Behaglichkeit oder Behäbigkeit allerdings versagt sich der Grandseigneur der „raunenden Beschwörung des [transsilvanischen] Imperfekts“ konsequent. Das Buch lebt von aparten Einfällen, Kreuz- und Querverweisen, verhaltener Situationskomik, sprachlichen Salti vitali und dem souveränen Mut, die epische Abrundung der Phantasie des Lesers zu überlassen. Umso verdienstvoller erscheint die – vorstellbare – Mühewaltung der treuesten Leserin, die der Verlag dem Vernehmen und der Widmung nach Eginald Schlattner auch diesmal zur Seite gestellt hat, sodass wir seine Erkenntlichkeit durchaus teilen: „In währender Danksagung Edith Konradt zugeeignet“.
Georg Aescht
Eginald Schlattner: „Die dritte Nacht“. Roman. Pop Verlag, Ludwigsburg, 2025, 168 Seiten, 19,90 Euro, ISBN 978-3-86356-410-0.Schlagwörter: Schlattner, Roman, Buchbesprechung
25 Bewertungen:
Noch keine Kommmentare zum Artikel.
Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.