12. Juni 2021
Unversöhnter Träumer: Geschichten aus Siebenbürgen von Géza Szőcs
Siebenbürgen, das „Land des Segens“ und die „süße Heimat“, ist den Siebenbürgern geraubt worden. Schuld sind allerdings nicht allein die Kommunisten und andere Übeltäter, nein, auch die „eigenen“, siebenbürgischen Künstler und Dichter haben seit einem geraumen Jahrhundert allerhand drangesetzt, die Gewissheiten, die heute noch bei allen Zusammenkünften hymnisch wehmütig beschworen werden, nach schöpferischen Kräften zu relativieren, vulgo madig zu machen. Das mag man bedauern, man muss aber auch diesen merk-würdigen Menschen zugestehen, dass sie nur das – in ihren Augen – Beste woll(t)en. Und das ist immer relativ und manchmal schmerzlich.
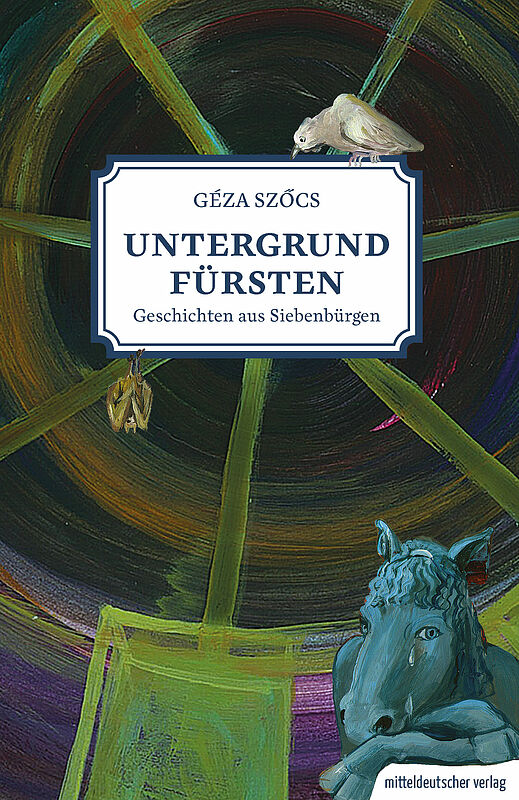
Die meisten Texte sind fiktive Dialoge mit dem Dichter János Sziveri, einem ahnungsreichen „Un-Wissenden“, der nie in Siebenbürgen gewesen ist, aber mit Geschichten von daselbst und dem Versprechen einer Reise dorthin über seine Krankheit getröstet werden soll. Dieser gibt Widerworte, stellt die Aussagen des Erzählers in Frage, allerdings nie das Erzählte – weil er es nicht kennt, aber „approximiert“ und sich zu eigen macht. So eröffnet Szőcs einen Freiraum für sein realistisches Spintisieren, das „real“ nur ein in jener Landschaft Gereifter nachvollziehen kann. Was keineswegs heißt, dass nicht auch „Ausländer“ mitreifen, sich einfühlen und Verständnis für eine Welt jenseits ihrer Vorstellung entwickeln können.
„An der Grenze zwischen Siebenbürgen und der anderen Welt steht ein Tor. (…) Noch dazu führen die siebenbürgischen Wege nicht direkt ins Jenseits. (…) Auch diese Wege schlängeln sich die Grenze entlang, kehren immer wieder zu sich selbst zurück.“ Wer sich nun eine Vorstellung von jenen siebenbürgischen Wegen machen will, der muss sie mit Géza Szőcs gehen. Etwa eine magisch gewundene Treppe hinauf zum Staatsverlag für Literatur und Kunst Espla in der Klausenburger Strada Horea, den es nicht mehr gibt, wo aber ein anderer gegründet worden sein könnte, „für den wir gemeinsam ein Buch schreiben könnten“, in das Eckhaus Hintz am Klausenburger Hauptplatz, wo „unsichtbare Fürsten in Gestalt streunender Katzen“ zu Beratungen zusammenkommen (die Bilder dazu, eine Tages- und eine Nachtansicht, sind ein Erlebnis, nicht nur für Klausenburger), in die Berge, wo noch eingebildete Daker leben, die den Szőcs Géza (ungarisch folgt der Vor- dem Nachnamen) kurzerhand vereinnahmen, oder nach Dój Máj, rumänisch Doi Mai, Zweiter Mai, „unweit des Schiffswracks Evangelium …“. Spätestens hier nun sträubt sich die siebenbürgisch-rumänische Erinnerung: Das Wrack der Evangelia lag vor Costinești, dafür gibt es Augen- und Schwimmzeugen.
Allerdings bleibt die Topographie dieser Erzählungen bei allen konkret nachvollziehbaren Ortsnennungen und historischen Klarnamen im Ungefähren, ebenso wie die Geschehnisse aller plausiblen Erklärungen enthoben, dafür aber aufs Schönste ent-, ja verrückt sind – worauf der Erzähler stets zu einer Deutung von nostalgisch getöntem Humor findet. Folgen wir dem Szőcs Géza nach Siebenbürgen, werden wir – naturgemäß – in die Irre gehen, aber ankommen.
Der ungarische Dichter Attila Jószef besprengt beim Liebeswerben sein Haar mit Petroleum und lässt es aus dem Fenster eines Bummelzuges flammen, wovon auch die Klausenburger Frauen Wind bekommen. „Nach alldem konnten Ständchen unter dem Fenster der Auserwählten in Klausenburg nur noch mit brennendem Haar gesungen werden. Deshalb haftet der siebenbürgischen Dichtung heute ein solcher Petroleumgeruch an.“ Die einhundertdreißig Wand- und Kuckucksuhren des Großvaters verkünden den Mittag, sind allerdings ungenau eingestellt, so dass Schlag Mittag fünf Minuten dauert, „ein nicht in Noten zu setzendes Musikwerk“: „Ich stellte mich an Punkten der Welt vor wie die Grenzlinie auf dem Mond, welche die dunkle von der hellen Seite des Mondes trennt. (…) Oder wenn die Mondfinsternis gerade einsetzt oder zu Ende geht. Wenn die Grille verstummt, die Nachtigall aber noch nicht ihren Gesang erklingen lässt. Wenn die Fahnder schon nach Hause gegangen sind, der Leichenwagen jedoch noch nicht eingetroffen ist.“
Landsleute von Szőcs wissen sehr wohl, wen sie sich unter „Fahndern“ vorzustellen haben. So vermag er einem immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, um es dann auch wieder gefrieren zu lassen. János Sziveri erkundigt sich angelegentlich: „Ist es tatsächlich so schrecklich bei euch dort?“ Auf die Antwort: „Noch schrecklicher“ hakt er nach: „Wieso begehen dann nicht alle Selbstmord?“, und erhält die irrwitzig ultimative Auskunft zum rumänischen Kommunismus: „Der wird schwer bestraft. Sogar der Versuch. Es ist vorgekommen, dass jemand hingerichtet worden ist, weil er versucht hat, sich umzubringen.“ Das ist das Land, in dem die Angst und Unmoral der Herrschenden sogar ihre Doppelgänger ansteckt, so dass diese sich ihrerseits Doppler halten, Doppeldoppler eben, wo im Gefängnis keine Uhr tickt, weil die Kommandantur die Zeit misst und verfügt, wo gegen den grassierenden Mangel auf Fabriks- und Friedhöfen Gemüse angebaut wird und wo sich die Sonnenblumen so heftig nach der Sonne drehen, dass sie ihre Hälse verrenken und sich selbst erwürgen. Das Land, dessen Realität man am ehesten mit Surrealismus beikommt.
Hans-Henning Paetzke schenkt uns mit seinem Abschied von dem Freund dessen im Verhältnis zu seiner grotesken Prosa versöhnlich schöne Verse: „Wenn der Mensch hinübergeht / in unterirdischen Raum, / liest Gott der Allmächtige / den ihm gereichten Traum.“
Georg Aescht
Géza Szőcs: „Untergrundfürsten“. Geschichten aus Siebenbürgen. Aus dem Ungarischen von Hans-Henning Paetzke. Mit 21 Illustrationen von Andrea Jánosi. Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale), 2021, 128 Seiten, 20,00 Euro, ISBN 978-3-96311-472-4.
Schlagwörter: Rezension, Literatur, Siebenbürgen, Ungarn, Erzählungen, Aescht
59 Bewertungen:
Noch keine Kommmentare zum Artikel.
Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.